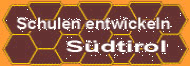| Das
deutschsprachige PISA-Siegerland heißt ... ?
Didaktiker
der Universität Siegen an erfolgreichem Unterricht beteiligt
Über die
Ursachen des Erfolgs kann man heftig spekulieren.
Liegt es am
integrativen Unterricht, der auch behinderte Kinder einschließt?
Dann müsste Italien insgesamt besonders gut abgeschnitten haben.
Aber im Durchschnitt liegen die Leistungen der italienischen 15-Jährigen
ein Schuljahr hinter ihren deutschen AltersgenossInnen und rund
zwei Jahre hinter denen in Südtirol.
Macht die Zweisprachigkeit
der Südtiroler Kinder diese sprachlich besonders fit? Auch
daran allein kann es wohl nicht liegen, wie die schlechteren Ergebnisse
in der Schweiz und vor allem in Luxemburg zeigen. Hat Südtirol
eine andere Schultradition, ist die sozio-ökonomische Situation
besser als in anderen Regionen – oder macht doch der Unterricht
den entscheidenden Unterschied aus?
In der Tat stellt
die pädagogische Konzeption eine Besonderheit
dar, wie Rudolf Meraner, Direktor des Pädagogischen
Instituts in Bozen, und der Südtiroler Schulamtsleiter
Peter Höllrigl in einer ersten Stellungnahme schreiben:
„Südtirols Schulen bieten förderliche Rahmenbedingungen
für individuelles, eigenverantwortliches Lernen. Die Neigungen
und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler werden
berücksichtigt, Talente gefördert und gestärkt.“
Durch eine systematische Fort- und Weiterbildung
sei eine neue Lernkultur in den Schulen entwickelt
worden. „Besonders eindrucksvoll lässt sich im Bereich
der Leseförderung zeigen, mit welchen Maßnahmen
die Südtiroler Schule es geschafft hat, vom Mittelmaß
(Lesestudie
1993) zu einem Spitzenplatz (PISA 2003) vorzustoßen.“
Helga
Pircher, Fachberaterin für den Sprachunterricht,
hat über 25 Jahre hinweg in verschiedenen Rollen Erfahrungen
im Südtiroler Grundschulwesen gesammelt. Sie hebt die vielfältigen
Projekte zur Leseförderung in den Schulen hervor,
die von allen Institutionen gestützt werden: „ ... In
Südtirol hat jedes Dorf eine öffentliche Bibliothek, wo
man kostenlos Bücher, Zeitschriften, Spiele und andere Medien
ausliehen kann.“
Seit vielen Jahren wird außerdem ein Unterricht propagiert
und mit konkreten Maßnahmen unterstützt, der
Lesen und Schreiben als persönlich und sozial bedeutsame Handlungen
fördert und nicht bloß als Techniken trainiert.
Vom ersten Schultag an schreiben die Kinder eigene Texte, sie wählen
sich ihre Lektüre selbst und marschieren nicht im Gleichschritt
durch einen kleinschrittigen Fibellehrgang. So steht es zumindest
im didaktischen Konzept „Die Schrift erfinden“ der Arbeitsgruppe
Primarstufe an der Universität Siegen, das in Südtirol
aktiv aufgenommen worden ist. |