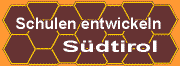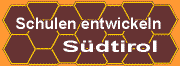| |
Gesellschaftliche
Veränderungen |
Reaktionen |
| |
|
Veränderte
Familienverhältnisse und Familienstrukturen:
Kleinfamilie, Einzelkind, berufstätige Eltern, Ganztagsarbeit, Rolle der
Frau, fehlende Vaterfigur, medialer Ersatz, Arbeitslosigkeit, finanzieller
Wohlstand, Fremdbetreuung der Kinder tagsüber, schlechtes Gewissen alleinerziehender
Elternteile, Rollentausch innerhalb der Familienkonstellation, starke Individualisierung,
Unstimmigkeit im Erziehungsauftrag |
Förderung
der sozialen und persönlichen Kompetenzen; emotionale Sicherheit, Selbständigkeit
fördern und lenken; Sen-sibilisierung für das "Anderssein", Rück-sichtnahme,
Respekt; Verzicht, Helfen, Teilen; Interaktionsspiele, Patenschaften, Elternarbeit
und interdisziplinäre Zusam-menarbeit, Elternaustausch, Transparenz, Kinderversammlungen,
Kinder lernen mit- und voneinander, Gesprächsräume schaffen, Feste, Feiern,
neues Rollenverständnis der Frau thematisieren, Methodenvielfalt, stufenübergreifende
Projekte, Ganztagsschule, flexible Schulzeiten und Stundenpläne, Fünftagewoche,
Wahlpflichtfächer und Freizeitangebote bieten, kritische Zeichen zur Konsumgesellschaft
setzen z.B. bei Feiern, Größe der Klassenräume, Schulhausgestaltung, Zusammenarbeit
mit verschiedenen Institutionen und sozialen Dienststellen, Psychologe an
jeder Schulstelle wünschenswert, Experten in die Schule holen, |
| |
|
| Veränderungen
im Lebensraum: veränderte Wohnsituation, kleine Wohnungen, Zunahme der Gefahrenquellen
|
praktische
Handhabung der Verkehrserziehung, Suchtprävention, Gesundheitserziehung
u.ä. praktizieren, Urteilsfähigkeit als wichtiges Erziehungsziel |
| |
|
| Körperliche
Bewegung: Bewegungsarmut durch vermehrten Aufenthalt im Haus, am Computer,
vor dem Fernseher, Idealisierung des Leistungssports in den Sportvereinen |
Bewegtes
und ganzheitliches Lernen, Spiele im Freien, vielfältige Angebote,Sportgruppen
bilden |
| |
|
| Wandel
in der Arbeitswelt:Arbeitsprozesse sind für Kinder nicht im-mer nachvollziehbar,
Technik übernimmt Produktion, Verlagerung des Arbeitsplatzes ins Ausland,
Leistungsdruck |
Produktionsprozesse
praktisch nachvollziehen, hin zum exemplarischen Wissen, Kontakte zur Wirtschaft
knüpfen und pflegen |
| |
|
| Interkulturelle
und multikulturelle Gesellschaft: Mobilität der Familien, berufstätige Eltern,
zunehmende Sprachkenntnisse sind erforderlich |
Förderung
vielfältiger Kompetenzen als Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen (Konfliktfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit, Gebrauch der verbalen und nonverbalen Kommunikation),
fundierte Allgemeinbildung, politische Mündigkeit, interkulturelles Lernen,
Sprachenerwerb, Schüleraustausch, Flexibilität |
| |
|
| Steigender
Medienkonsum:Fernsehen und neue Medien sind in allen Familien präsent, veränderter
Informationsfluss, Einfluss der Werbung,Vermittlung einer unwirklichen Welt,
Suggestion von Gewalt, Macht, Schönheitsidealen und Modetrends |
Kritischer
Umgang mit Medien, mit der Vielfalt an Informationen leben, kreativ umgehen
und filtern, Wissen verknüpfen, Verhaltensmuster überdenken, Realitätsbezug
herstellen, Sinnesschulung, Kompetenzenerwerb |
| |
|
| Übermacht
der Wirtschaft:Wirtschaft manipuliert Glaubenssätze und deponiert ihre Bedürfnisse,
Druck erzeugt Gegendruck, Zusammenhang der Leistung und des Bildungsniveaus
der Familien, Kosten der Hochschulbildung |
Werterziehung,
Aufwertung der Selbst- und Sozialkompetenzen |
| |
|
| Werte
und Haltungen: Prägung durch Kirche, Traditionen, Wirtschaft und Medien,
Enttabuisierung in vielen Bereichen, Mitsprache der Kinder, Verunsicherung
in der Wertehaltung, Un-terhaltungskonsum, Schnelllebigkeit, Leistungsdruck
|
Umgang
mit persönlichem und fremdem Eigentum, Vorbildfunktion der Lehrpersonen
im Leben von Werten und Haltungen, Empathie, Wertschätzung, Toleranz, Re-spekt,
Liebe, Beziehungsfähigkeit, Risikofreude, Ziele und Visionen, Ehrgeiz, Selbst-
und Fremdeinschätzung, Kooperation (Arbeiten im Team), Selbstdisziplin,
Vereinbarungen treffen und einhalten, Grenzen und Freiräume gewähren, Um-gang
mit Unvorhergesehenem, als Schule vermehrt Erziehungsarbeit leisten, Ich-Stärke
vermitteln, Schwächen abbauen, Stärken erweitern und vertiefen, SchülerInnen
zum verantwortungsbewussten Handeln hinführen, Problemlösestrategien erarbeiten
und erproben, voneinan-der und miteinander lernen, im Spiel Sozial- und
Selbstkompetenzen erwerben, Umgang mit Misserfolgen und Erfolgen, sozialen
Fähigkeiten in der Bewertung hervorheben, Lernstrategien aneignen, eigenverantwortliches
Lernen und individuelles Lerntempo zulassen, bewegtes Lernen ermöglichen,
Mut zur Lücke, Ruhephasen anbieten, Stille erfahren, ge-naues Betrachten
innerer und äußerer Bilder, Phantasiereisen, "der Weg ist das Ziel", Gesprächskultur
pflegen, aktives Zuhören üben, Kreativität fördern, Flexibilität in der
Planung |
| |
|
| Verändertes
Berufsbild der Lehrpersonen:Neben dem Vermitteln von Wissen wird der beratenden
Funktion beim Lernen Bedeutung beigemessen, Leistungsdruck der Gesellschaft,
Schule als Reparaturwerkstätte bzw. als Sündenbock der Gesellschaft, Übergewicht
der Frauen im Lehrberuf |
Rolle
der Lehrpersonen neu überdenken, Lehrpersonen als "Menschen" nicht ver-gessen,
Kompetenzbereiche klar abstecken, Supervisoren einsetzen, Sabbatjahre gewähren,
Aufwertung des Lehrberufs, geschlechtspezifisches Gleichgewicht in der Lehrerschaft
anstreben |