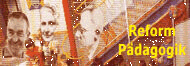|
|
|
|
|
|
|
Der
Konstruktivismus
Der
Sozio-Konstruktivismus
Gegenseitige Abhängigkeit von Lernen und Kontext
Der sozio-kognitive Konflikt
Die Metakognition
Übersicht
|
|
Der
Sozio-Konstruktivismus
Obwohl die Konstruktion
des Wissens eine persönliche Leistung des Individuums ist, findet
sie doch in einem sozialen Rahmen statt. Das Wissen steht in engem Zusammenhang
mit dem sozialen Milieu und dem Kontext, und es entwickelt sich sowohl
auf Grund dessen, was der Lerner selber denkt, wie auch auf Grund dessen,
was andere an Interaktionen beitragen.
Gegenseitige
Abhängigkeit von Lernen und Kontext
Der
Erwerb von Wissen hängt ab vom pädagogischen Kontext, d.h. von
der Lehr- und Lernsituation und den damit verbundenen Aktivitäten.
Lave (1988), Brown, Collins und Duguid (1989) behaupten, dass Lernen die
Interpretation einer Erfahrung oder eines Phänomens ist, die man
in ihrem Kontext erfasst hat. Die Anhänger des Kontextlernens (situated
learnng) schlagen vor, für Lernsituationen auf authentische Aufgaben
in möglichst realistischen Kontexten zurückzugreifen. Die Schwierigkeit,
kontextuelles Lernen in der Praxis zu verwirklichen, verlangt vom Lehrer
die Berücksichtigung von verschiedenen pädagogischen Variablen.
Berücksichtigt werden müssen:
- Die Wichtigkeit
der Verwertung der Informationen aus der Lernumwelt
- die Komplexität
der Lernsituation
- die Ausrichtung
des Lernens auf den Erwerb von gezielten Kompetenzen
- und die Fähigkeit,
den Lerner über sein eigenes kognitives Vorgehen aufzuklären.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Der
sozio-kognitive Konflikt
Der Begriff des sozio-kognitiven
Konflikts stellt einen wichtigen Unterschied zur individualistischen Position
von Piaget dar
Wygotsky betont, dass die sozialen Interaktionen
bei jedem Lernprozess entscheidend sind. Er hat den Begriff der Zone
der nächsten Entwicklung geprägt.
Doise und Mugny haben
die Arbeiten von Piaget und Wygotsky weitergeführt. Sie betonen,
dass die Interaktionen zwischen den Lernenden eine wichtige Quelle der
kognitiven Entwicklung sind, vorausgesetzt, sie führen zu sozio-kognitiven
Konflikten. Nach diesen zwei Autoren ist die soziale Interaktion konstruktiv
in dem Maße, wie sie zu einer Konfrontation zwischen divergierenden
Positionen führt. Ein erstes interindividuelles Ungleichgewicht entsteht
in der Gruppe, weil jeder Schüler mit divergierenden Standpunkten
konfrontiert wird. So wird er sich des eigenen Denkens im Vergleich mit
dem Denken der anderen Schüler bewusst. Und das führt zu einem
zweiten interindividuellen Ungleichgewicht: Der Lerner muss gleichzeitig
die eigenen Vorstellungen und die der anderen überdenken, um ein
neues Wissen zu konstruieren. Es geht also darum - mit den Worten von
Bruner (1995)- , "unser eigenes Denken zu denken", und das heißt,
ein Verständnis zu entwickeln sowohl für unsere eigenen kognitiven
Prozesse wie für die der anderen.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Die
Metakognition
Metakognition bezeichnet
die Analyse, die der Lernende von seinem eigenen intellektuellen Funktionieren
macht. Wissen, dass man Schwierigkeiten mit dem Bruchrechnen hat, wissen,
dass man ein Problem besser versteht, wenn man sich ein Schema macht,
sind Beispiele von metakognitivem Wissen. Metakognition verweist auf die
kognitiven Aktivitäten, die für die Durchführung einer
Aufgabe und die genaue Steuerung des Prozesses nötig sind (Steuerung
der geistigen Aktivität).
Metakognition
bezeichnet die Kompetenz, sich Fragen zu stellen, um sein Handeln zu steuern
und sein Handeln im Hinblick auf das Ziel ständig zu bewerten, und
zwar vor, während und nach der Durchführung der Aufgabe, um
sich gegebenenfalls neu zu orientieren und sein Verhalten anzupassen.
Es kommt dabei darauf an, sich seiner eigenen Denkprozesse bewusst zu
werden und sie entsprechend der Aufgabe genau zu steuern.
|
|
|
|
|