|
|
|
|
|
|
|
Auszüge aus einem
Vorabbericht zum Symposium "Neue Medien und Schulentwicklung"
am 25. Februar 2002 an der Universität Bielefeld; Autor: Prof. Dr. Witlof
Vollstädt, Kassel im Januar 2002
Eine vollständige Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation
sind dem Abschlussbericht des Forschungsvorhabens zu entnehmen.
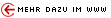
http://www.paedagogik.uni-bielefeld.de/agn/ag4/WE-LS/Deutsch/Absolv/Delphi
|
| ... |
|
Zum
Anliegen der Studie
|
|
Die Delphi-Studie bezieht sich darauf, wie sich die Lehr- und Lernmedien
zukünftig entwickeln werden, welche Rolle sie bei der Vermittlung und Aneignung
schulischer Allgemeinbildung leisten sollen und können, welche bildungspolitischen,
schulpädagogischen und fachdidaktischen Erfordernisse bei der Entwicklung
neuer Medien zu berücksichtigen sind. Initiiert und finanziert wurde die
vorliegende Delphi-Studie von der Cornelsen-Stiftung "Lehren und Lernen".
|
|
|
|
... |
|
Der
Begriff der "Lehr- und Lernmedien" in dieser Studie
|
|
Dabei
wurden unter "Lehr- und Lernmedien" verstanden: sämtliche Präsentationsformen
von Lerninhalten, von den Printmedien bis zu den elektronischen Medien (Folie,
Buch, MC, VC, Internet-Online, Offline-Produkte, Hörfunk- und Fernsehsendungen
u. a. m.), die Lernende in und außerhalb der Schule zur Informationsaufnahme
und -verarbeitung nutzen können. |
|
|
|
... |
|
Das
Delphi-Verfahren
|
|
Das
Delphi-Verfahren ist eine Forschungsmethode, mit der das Erfahrungswissen
von Experten genutzt wird, um Aussagen über zukünftige Entwicklungen
zu erhalten. Wesentliche Kennzeichen dieser Methode sind die Mehrstufigkeit
der Befragung und die Rückkopplung der jeweiligen Ergebnisse. In der Regel
werden die gleichen Fragen durch ausgewählte Experten, die untereinander
anonym bleiben und sich damit gegenseitig nicht beeinflussen können, mehrmals
bearbeitet. |
|
|
|
... |
|
Beschreibung
der Stichprobe
|
|
An der schriftlichen
Befragung beteiligten sich in der ersten Runde 93 Experten (Vertreter
aus Hochschule, Forschungsinstituten, Praxis, Verlagen und Rundfunk/Fernsehen).
An der 3. Befragungsrunde waren immerhin noch 70 Prozent der Experten
beteiligt.
|
| ... |
|
Kurzfassung
der Ergebnisse in Form von Thesen
|
| ... |
|
Die
Erwartungen an die zukünftige Entwicklung der Lehr- und Lernmedien und
ihre Nutzung liegen zwischen vorsichtigem Optimismus und pessimistischen
Befürchtungen.
|
|
Die deutlichsten Veränderungen werden bei alle jenen Medien erwartet, die
mit der Nutzung des Computers verbunden sind. Vielleicht zeigen sich in
der ausgewogenen Position auch die Erfahrungen mit bisherigen Modernisierungstendenzen
und ein gewisser Realitätssinn. Immerhin bezweifeln etwa zwei Drittel der
Experten, dass ausreichend staatliche Mittel zur Verfügung stehen, um den
Bedarf der Schulen an neuen Medien zu erfüllen. |
|
|
|
... |
|
Es
gibt keine Modernisierungseuphorie bezüglich der Lehr- und Lernmedien,
auch die bisherigen Medien behalten ihre Bedeutung, verändert werden muss
vor allem die Lernkultur.
|
|
In der Tendenz erwarten
die befragten Experten, dass vor allem die Nutzung der neuen Medien zunehmen
wird. Danach folgen mit 40% die Schulbücher und mit etwas weniger Prozentpunkten
die übrigen Medien. Lediglich den DIA-Reihen wird kaum noch eine Chance
eingeräumt. Die neuen Medien werden als eine innovative Ergänzung und
Erweiterung angesehen, die zugleich Chancen für eine veränderte Lernkultur
schaffen. Dies erwarten 73 Prozent der Experten. Als Gründe werden die
mit neuen Medien verbundenen Lernanforderungen und Lernmöglichkeiten aufgeführt:
- mehr Selbständigkeit,
Eigenaktivität, Selbstorganisation der Lernprozesse
- individuelle Lernformen
sind möglich
- aber auch mehr
soziales Lernen und Teamfähigkeit erforderlich
- interaktives Arbeiten
wird gefördert
- direktes Feedback
ist möglich
- Rollenverteilung
Lehrer/Schüler verändert sich, Schüler übernehmen Lehrfunktionen
- Aktualität der
Inhalte kann problemlos verändert werden
- schnellerer Zugriff
zu Unterrichtsinhalten möglich
Allerdings geben die
Experten auch zu bedenken, dass neue Lehr- und Lernmedien nicht automatisch
zu einer neuen Lernkultur führen, sondern lediglich die Chance zur Veränderung
eröffnen. Die Einstellungen der Lehrkräfte zu den neuen Medien und entsprechende
Einsatzkonzepte bzw. Lernarrangements werden maßgeblichen Anteil daran
haben, ob die erwarteten Effekte eintreten, ob es zur Veränderung der
Lernkultur kommt oder nicht.
|
|
|
|
... |
|
Die
Zustimmung zu neuen Medien lässt nicht zwangsläufig auf die persönliche
Bereitschaft zur intensiven Nutzung schließen.
|
|
Als erforderliche
Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer beim Umgang mit neuen Medien wurden
erstrangig genannt:
- Erkennen individueller
Lernprobleme der Schüler
- Zielgerichtete
Auswahl und Nutzung der Medien
- Überprüfung des
Wahrheitsgehalts von Informationen
- Effizientes Suchen
und Recherchieren mit dem PC
- Sichere Bedienung
von Standardsoftware
- Kritische Informationsauswahl
Kompetenter Umgang
und kritische Distanz werden gleichermaßen als wichtige Voraussetzungen
für den Umgang der Lehrer(innen) mit den Lehr- und Lernmedien angesehen.
Lehrkräfte befürchten eine gewisse Entmündigung in ihrer didaktischen
Kompetenz durch neue Medien, betonen aber nach wie vor ihre fachliche
Kompetenz im Umgang mit ihnen.
|
|
|
|
... |
|
Da
von den neuen Lehr- und Lernmedien nur geringe eigene Innovationskräfte
erwartet werden, wird deren curriculare Verankerung gewünscht.
|
|
Um die eben erläuterte
Zurückhaltung von Lehrkräften gegenüber neuen Medien zu überwinden, erwarten
fast 80 Prozent der Experten eine verbindliche Verankerung des Umgangs
mit ihnen in den Lehrplänen. Als hauptsächliche Begründung wird hierfür
der Wunsch nach einem erforderlichen Druckmittel gegen eine gewisse "Entwicklungsresistenz"
angegeben. Vielleicht kann so die Fortbildungsbereitschaft der Lehrer(innen)
im Umgang mit neuen Medien stimuliert werden.
|
|
|
|
... |
|
Von
der Lehrerausbildung wird auch in Zukunft wenig Hilfe bei der Befähigung
zum Umgang mit neuen Medien erwartet.
|
|
Wenn die staatlichen
Lehrpläne wenig Einfluss auf den Umgang mit neuen Medien nehmen, bleibt
als Alternative vor allem die Lehreraus- und -fortbildung. Allerdings
befürchten fast 70 Prozent der befragten Experten, dass auch künftig in
der Lehrerausbildung zu wenig für die systematische Vermittlung von Medienkompetenz
getan wird. Diese Befürchtung scheint berechtigt, zumal die befragten
Studenten mehrheitlich bestätigten, dass die Fachausbildung bezüglich
der Mediennutzung als konventionell und konservativ eingeschätzt wird.
|
|
|
|
... |
| Weitere
Entwicklungstendenzen |
| ... |
|
Neue
Medien und Lernkultur
|
|
Neue Medien ermöglichen
und erfordern eine veränderte schulische Lernkultur. Nach Meinung der
befragten Experten geht es dabei vor allem um folgende Veränderungen:
- Erweiterung der
Unterrichtsinhalte
- verstärktes eigenverantwortliches
Lernen
- gemeinsame Planung
und Organisation des Unterrichts durch Lehrer und Schüler
- Öffnung des Unterrichts
für außerschulische Lernorte
- Schülerkooperation
und Kommunikation mit dem Lehrer beim Lernen über Internet.
Fast 80 Prozent der
Experten vertreten die Auffassung, dass mit neuen Medien tatsächlich eine
höhere Qualität des selbstständigen Lernens der Schüler(innen) erreicht
werden kann.
|
|
|
|
... |
|
Erforderliche
Konsequenzen für die Lehrkräfte
|
|
Die veränderte Medienvielfalt
beim Lehren und Lernen in der Schule führt nicht nur zur Veränderung der
Lernorte und der Lernqualität, sondern beeinflusst auch die didaktisch-methodische
Gestaltung schulischer Lernprozesse und erfordert von den Lehrerinnen
und Lehrern besondere Kompetenzen. Nach Meinung der befragten Experten
müssen die Lehrkräfte vor allem
- ihre mediendidaktische
Kompetenz erheblich erweitern
- weniger Informationen
und Instruktionen, dafür mehr Lernberatung geben
- zukünftig Lernprozesse
stärker moderieren als leiten
- verstärkt Gruppenarbeit
anbieten und organisieren.
|
|
|
|
... |
|
Die
didaktischen Aufgaben der Lehrer(innen) werden nach Meinung der Experten
differenzierter und spezieller.
|
|
Der Bedarf an sozialpädagogischer
Beratung in der Schule wird wachsen. Mehrfach wurde Teamfähigkeit und
interdisziplinäres Arbeiten der Lehrerinnen und Lehrer als wichtige Voraussetzungen
genannt. Der Umgang mit neuen Medien sollte fester Bestandteil der Lehrerausbildung
sein. In Fortbildungsveranstaltungen sollten verstärkt medienpädagogische
Kenntnisse vermittelt werden, wobei der Anteil schulinterner Fortbildung
deutlich wachsen müsste. In solchen Fortbildungsveranstaltungen sollte
es vor allem um folgende Kompetenzen gehen:
- Erkennen individueller
Lernprobleme der Schüler
- zielgerichtete
Auswahl und Nutzung der Medien
- Sichere Bedienung
von Standardsoftware
- Kritische Informationsauswahl
- Überprüfung des
Wahrheitsgehalts von Informationen
- Effizientes Suchen
und Recherchieren mit dem PC
- Kenntnis und Beherrschung
von Präsentationstechniken
- Sichere Anwendung
fachspezifischer Software
- Auswahl geeigneter
Medien für die jeweiligen Lehrinhalte
- Kenntnisse über
Mediennutzung von Jugendlichen
- Förderung der Konzentrationsfähigkeit
der Schüler
- Fähigkeit zur Binnendifferenzierung
- Moderationsfähigkeiten
- Fähigkeiten zur
Lernberatung
- Entwicklung von
Bewertungsverfahren für die mit neuen Medien erbrachten Leistungen
- Fähigkeiten zum
Methodentraining
- gute Kenntnisse
der englischen Sprache
- Kenntnisse über
psychologische Grundlagen des Lernens mit Medien
- Erkennen und Beheben
einfacher technischer Störungen von neuen Medien
- Fähigkeiten zu
Pädagogischer Diagnostik
Da Grundkenntnisse
in Informatik von den Lehrerinnen und Lehrer mit geringer Bedeutung eingestuft
wurden, kann angenommen werden, dass die neuen Medien stärker anwendungsbezogen
genutzt werden.
|
|
|
|
... |
|
Notwendige
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler
|
|
Auch die Schülerinnen
und Schüler benötigen zum effektiven Lernen mit neuen Lehr- und Lernmedien
besondere Kompetenzen.
(Die Zahl hinter der Kompetenz bedeutet einen Mittelwert von: voller Zustimmung
(1) bis voller Ablehnung (6))
- Kritische Informationsauswahl
1,4
- Überprüfung des
Wahrheitsgehalts von Informationen 1,4
- Sichere Bedienung
von Standardsoftware 1,5
- Effizientes Suchen
und Recherchieren mit dem PC 1,5
- Zielgerichtete
Auswahl und Nutzung der Medien 1,5
- Differenzierung
von realer und virtueller Welt 1,6
- Kritisches Reflexionsvermögen
1,6
- E-Mail versenden
und empfangen 1,6
- Neugier und Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Medien 1,8
- Experimentierfreude
1,8
- Problemlösungskompetenz
1,8
- Fähigkeit zur
Auswahl der effektivsten Arbeitsmethode 1,8
- Informationsgewinnung
durch "Lesen" von Tabellen/ Bildern 1,8
- Nutzung der Medienvielfalt
zur Präsentation eigener Arbeitsergebnisse 1,8
- Konzentrationsfähigkeit
1,9
- Analytisches Vorgehen
1,9
- Kreativität 2,0
- Abstraktionsvermögen
2,0
- Gute Kenntnisse
der englischen Sprache 2,0
- Selbstbestimmtes
Lernen 2,0
- Teamfähigkeit
2,2
- Fähigkeit zu kooperativem
Lernen 2,2
- Datenschutz im
Umgang mit neuen Medien 2,2
- Darstellung/Präsentation
auch komplexer Inhalte 2,2
- Sprachliches Ausdrucksvermögen
2,3
- Netiquette (Verhaltensregeln
im Internet) 2,3
- Soziale Kompetenz
2,4
- Internetbezogene
Sprachkenntnisse 2,4
- Forscherdrang 2,5
In allen drei Befragungsrunden
zeigten die Antworten deutliche Diskrepanzen zwischen den Notwendigkeiten/Erfordernissen
neuer Medien für schulisches Lernen und den Erwartungen an die künftige
Realität in den staatlichen Schulen. Schulpolitische Konsequenzen werden
erwartet, die sich nicht nur auf die Ausstattung mit der erforderlichen
Hardware beziehen. Vor allem wird eine Veränderung des Arbeitszeitmodells
der Lehrer(innen) erwartet, weil sich auch die Lehrerarbeit durch den
Umgang mit neuen Medien erheblich verändert. So wird z. B. angenommen,
dass Lehrer zukünftig auch an Nachmittagen in der Schule präsent sein
müssen.
|
|
|
|
... |
|
Literatur:
|
|
Bildungsministerium
für Bildung und Forschung: Delphi-Befragung 1996/1998. Potentiale und Dimensionen
der Wissensgesellschaft - Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen.
Endbericht. Basel 1998.
Reinmann-Rothmeier, Gabi/Mandl, Heinz: Wissensmanagement. Eine Delphi-Studie
(Forschungsbericht Nr. 90). München: Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl
für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, 1998. |
|
|
|












