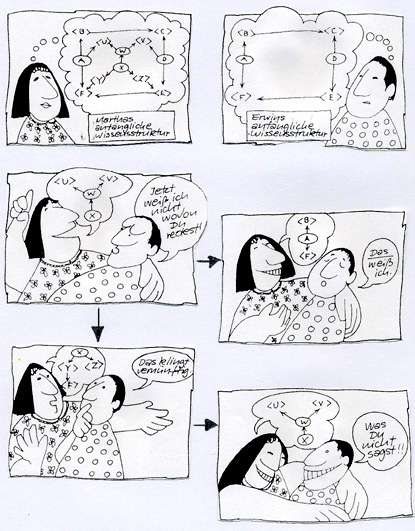|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Multicodierung
und Multimodalität
|
|
Mediale
Angebote (u.a. in Neuen Medien) zeichnen sich nach Bernd Weidenmann durch
absichtsvoll codierte und strukturierte Inhalte aus, wobei die Codierung
(multicodal) in konventionalisierten Symbolsystemen erfolgt, die unterschiedliche
Sinne (multimodal) ansprechen soll. In der Strukturierung der Inhalte
realisiert sich eine "instruktionale" Strategie.
|
|
|
.... |
.... |
Naive
Annahmen zu Multimedia
Die
folgenden Ausführungen beziehen sich insbesonere auf das Lernen
mit Neuen Medien. Ein Transfer auf die Lern-Metaphern "Lernen mit
allen Sinnen" oder "Lernen mit Kopf, Herz und Hand" sind
aber leicht möglich.
|
|
Zum
Einfluss von Multicodierung und Multimodalität auf den Wissenserwerb
deckt Weidenmann einige naive Annahmen auf. Die am meisten verbreitete lautet:
"Multimedia spricht mehrere Sinneskanäle an; das verbessert das Behalten."
Es ist naiv zu glauben, dass sich die Prozentsätze der beteiligten
Sinne einfach summieren (z. B. Hören 20%, Sehen 30%, Hören und
Sehen dann 20% + 30% = 50%). Historisch verbirgt sich hinter dieser Annahme
auch die Höherwertigkeit der Wahrnehmung eines realen Gegenstandes
gegenüber seiner symbolischen Darstellung. Auch hirnphysiologische
Befunde werden gerne dahingehend trivialisiert, dass man durch ein gleichzeitiges
Angebot von Sprache und Bildern beide Hirnhälften einschalten müsse
und damit die Lern- und Behaltensleistung erhöhen können. |
|
|
|
.... |
|
Neben
den Sinneskanälen sind die internen Codierungen und spezialisierte
"konzeptuelle Systeme" wichtig.
|
|
Aus
kognitionspsychologischer Sicht, so Weidenmann weiter, sind beim Lernen
und Verstehen nicht die jeweils angesprochenen Sinneskanäle wichtig,
sondern die "internen" Codierungen und Verarbeitungsprozesse. Durch Lesen
eines Textes oder durch Wahrnehmen von Bildern werden die sinnhaften Eindrücke
im kognitiven Apparat durch Wortmarken oder Bildmarken repräsentiert
und diese sind modalitätsspezifisch: so gibt es beim Hören von
Sprache akustische Wortmarken (Phonemik), beim Lesen von Sprache visuelle
Wortmarken (Graphemik) und beim Wahrnehmen von Bildern Bildmarken, die das
Erscheinungsbild (z. B. in Form, Farbe und Textur) repräsentieren.
In Interaktion mit einem ebenfalls auf nonverbale oder verbale Bereiche
spezialisierten "konzeptuellen System", wird dann die eigentliche Bedeutung
der wahrgenommenen und repräsentierten Inhalte bestimmt. |
|
|
|
|
|
Behaltensvorteil
für multicodal präsentierte Information
|
|
Empirisch
gut belegt ist die positive Wirkung von Illustrationen auf das Behalten
von Text. Die förderliche Wirkung wird damit erklärt, dass der
Nutzer sogenannte "referentielle Verknüpfungen" zwischen verbalen und
visuellen Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis herstellt. Mit
der konzeptnäheren Verarbeitung von Bildern und der aufwendigen Enkodierung
bei Text-Bild-Kombinationen lässt sich für Weidenmann auch der
empirisch gut abgesicherte Befund verstehen, wonach sich ein ergibt. |
|
|
.... |
.... |
|
Eine
Karikatur zur Bedeutung von bereits konstruierten Wissensstrukturen
|
|
|
|
|
.... |
 |
|
Entscheidend
für das Behalten ist die mentale Anstrengung des Lerners
|
|
Die
investierte mentale Anstrengung eines Lerners, sich mit dem Lernmaterial
auseinanderzusetzen, steht in einer ausgeprägt positiven Beziehung
zum Lernerfolg. Es zeigte sich aber z.B. auch, dass beim Lernen mit dem
Buch mehr Interferenzen über das unmittelbar Präsentierte hinausgehend
gebildet wurden, als beim Betrachten eines Filmes. Rasche Bildsequenzen,
also das gleichzeitige Angebote von Sprache, Bildern und Spezialeffekten,
erschweren eine intensive Auseinandersetzung. Multimediale Lernangebote
werden zwar als angenehm und interessant erlebt, aber u. U. weniger intensiv
verarbeitet. So werden bildhafte Darstellungsformen, besonders dann wenn
sie durch Bewegung, Form und Farbe realitätsnah sind, eher als leicht
rezipierbar wahrgenommen und dann nicht tief genug verarbeitet. |
|
|
|
.... |
|
Gefahr
der Überlastung und Interferenzen der Sinne
|
|
Beim
Einsatz multimedialer Lernangebote sollte man nach Weidenmann also auch
die Befunde beachten, dass die Sinne anfällig für Überlastung
und Interferenzen sind. Für Multimedia sprechen aber Studien, wonach
sich diese Überlastung reduzieren lässt, in dem man das Informationsangebot
auf unterschiedliche Sinn-Modalitäten verteilt und unterschiedliche
Codierungen benutzt. Derzeit wird bei Lernmaterialien oft nur die visuelle
Modalität angesprochen (Texte, Bilder). Die Einbeziehung der auditiven
Modalität eröffnet neue attraktive Möglichkeiten. Es wirkt
entlastend, wenn komplexe Bilder oder Bilderfolgen nicht ebenfalls visuell
(durch Text), sondern auditiv (gesprochener Kommentar) erläutert werden. |
|
|
|
.... |
|
Schlußfolgerungen
|
|
Multicodierte
und Multimodale Präsentation kann in besonderer Weise eine mentale
Multicodierung des Lerngegenstandes durch den Lerner stimmulieren. Dies
verbessert die Verfügbarkeit des Wissens.
Mit Multicodierung
und Multimodalität gelingt es besonders gut, komplexe authentische
Situationen realitätsnah zu präsentieren und den Lerngegenstand
aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Kontexten und auf unterschiedlichem
Abstraktionsniveaus darzustellen. Dies fördert Interesse am Gegenstand,
flexibles Denken, die Entwicklung adäquater Modelle und anwendbares
Wissen
|
| |
|
... |
| ... |
..... |
... |
|
|
|
... |
|
Einige
Literaturhinweise zur Vertiefung
|
|
Weidenmann, Bernd:
Multicodierung und Multimodalität im Lernprozeß, in: L.J. Issing
und P. Klimsa (Hg): Information und Lernen mit Multimedia, Beltz, Weinheim
1995.
Weidenmann, Bernd: Lernen mit Bildmedien, Weinheim: Beltz, 2. Auflage
1994
Weidenmann, Bernd: Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder
in Printmedien, Film- Video- und Computerprogrammen, Huber, Bern 1994
|