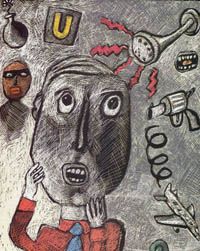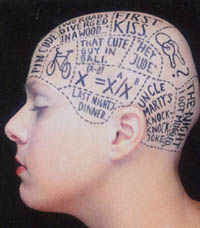|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Das
Gehirn ist ein operational geschlossenes und selbstreferentielles System,
welches aber mit der "Außenwelt" gekoppelt ist.
Es hat gestaltende Kraft!
Gedächtnisinhalte sind in
dispositionellen neuronalen Mustern abgelegt.
|
|
Die Wirklichkeit unseres Erlebens ist keine
passive Rezeption: Das Gehirn hat gestaltende Kraft. Unser Wissen ist
also nicht eindeutig durch die von außen kommenden Signale/Reize
determiniert, sondern "durch das Vorwissen, den semantischen Kontext,
in dem sie empfangen werden" (Roth,1998, S 107).
"...
Hypothesen, die unser Wahrnehmen und damit unser Denken bestimmen, bestehen
in jedem Augenblick. ... Solche Vorurteile gehören so zu uns wie
das Atmen, wir müssen permanent mit ihnen leben" (Pöppel,1993,
S 176).
Aus
Signalen/Reizen, die Informationen übertragen, wird individuelles
Wissen; es ist in dispositionellen neuronalen Mustern "gespeichert" (sie
werden auch Gedächtnisinhalte genannt) (Braitenberg,1990, S 84).
Die neuronalen Netzwerke umfassen dabei Hunderte von Millionen von Nervenverbindungen,
die sich immer auf (sehr viele) unterschiedliche Hirnbereiche verteilen.
|
| |
|
|
| |
|
 Positronen-Emissions-Tomografien;
(PET)-Diagramme
Positronen-Emissions-Tomografien;
(PET)-Diagramme |
| |
|
|
|
Topologien
der Außenwelt bleiben im Gehirn erhalten
|
|
"Das
Verblüffende bei der Fortleitung von der Peripherie der Informationsaufnahme
ins Zentrum weiterer Verarbeitung und Bewertung ist (aber z.B.), dass die
topologischen Beziehungen von vorgefundenen Objekten in der Welt in der
neuronalen Repräsentation im Gehirn ... erhalten bleiben" (Pöppel,
1993, S 173). |
| |
|
|
|
Die
Grundfunktionen des Gehirns sind vererbt, aber die volle Funktionsfähigkeit
erhält das Gehirn durch Signale aus der Umwelt
|
|
"Der Cortex gleicht
... einem Netzwerk von diffusen, durch Aktivität veränderlichen
Verbindungen. Nur die Grundzüge der Verschaltung sind bei der Geburt
vorgegeben. ... "Art und Umfang frühkindlicher Erfahrung bestimmen
(dabei) die spätere Leistungsfähigkeit des Zentralnervensystems:
Signale aus der Umwelt optimieren offenbar die zunächst relativ ungenaue
Verschaltung der Nervenzellen" [Singer, 1990, S 50]. Seine volle Funktionsfähigkeit
erhält er in der Auseinandersetzung mit der Umwelt: durch Koppeln
gleichzeitig aktiver Zellen zu Ensembles, durch Stärken oder Schwächen
der Verbindungen an plastischen Synapsen" (Braitenberg, 1990, S 194).
|
| |
|
|
|
Kognitionen
sind nicht ohne Emotionen möglich.
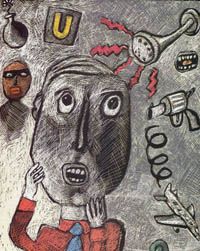
Bild: Angst essen Seele auf!
|
|
Neuere wissenschaftliche
Studien lassen darauf schließen, dass bei Lernprozessen, Denkprozessen,
Verstehensprozessen, Wahrnehmungsprozessen, Erfahrungsprozessen, Mitfühlprozessen
oder Verständigungsprozessen, die allesamt Aufmerksamkeit verlangen und
ein Arbeitsgedächtnis fordern, nicht nur Bereiche der Großhirnrinde (Neocortex),
sondern immer auch die präfontalen Hirnlappen sowie das limbische System
beteiligt sind.
"Die emotionalen
Zentren (u.a. im limbischen System) sind aus ... dem Hirnstamm hervorgegangen.
Es hat Jahrmillionen gedauert, bis aus diesen emotionalen Bereichen das
hervorging, was sich schließlich zum denkenden Gehirn entwickelte ...".
"Die letzten zehntausend Jahre, ... haben in den biologischen Grundformen
unseres Gefühlslebens kaum eine Spur hinterlassen." (Goleman, 1997, S
21 und 27)
Wenn wir Signale/Reize
über die Sinnesorgane aufnehmen, dann wird die im Gehirn entstehende
neuronale Erregung nicht nur kognitiv interpretiert, sondern immer auch
gleichzeitig emotional bewertet.
Es wird versucht,
die Begriffe Signale (Nachrichtentechnik) oder Reize (Biologie, Psychologie)
und Information (Kognitionswissenschaften, Informatik) sowie Wissen (Wissenspsychologie,
Erziehungswissenschaften) auseinander zu halten. Signale oder Reize tragen
neben einer Vorkommens-Wahrscheinlichkeit sonst keine weitere Bedeutung.
Der Begriff Information impliziert immer auch eine Bedeutung. Von Wissen
wird als Ergebnis des Lernens = Denkens = Erkennens gesprochen.
"Kognitionen
sind nicht ohne Emotionen möglich" (Roth,1998, S 211f). Und ein "Mangel
an Gefühlen kann eine genauso wichtige Ursache für irrationales
Verhalten sein" (Damasio,1995, S. 87) "Die
allgemeine Funktion des limbischen Systems besteht in der Bewertung dessen,
was das Gehirn tut. Dies geschieht einerseits nach den Grundkriterien
"Lust" und "Unlust" und nach Kriterien, die davon abgeleitet sind. Das
Resultat dieser Bewertung wird (als neuronales Netzwerk) im Gedächtnissystem
festgehalten" (Roth,1998, S 209). Es bildet das erfahrungs- und wahrnehmungsbezogene,
nicht ererbte Wissen.
|
|
|
|
|
Die
neueronale Verschaltungsgrundlage
|
|
Im Gehirn gibt es
schätzungsweise eine Billionen Nervenzellen (1000.000.000.000). Jede Nervenzelle
hat Kontakt mit vielen anderen Nervenzellen; man vermutet:
- dass 1000 Nervenzellen
von einer Nervenzelle beeinflusst werden (Prinzip der Divergenz) und
- dass jede einzelne
Nervenzelle von 1000 Nervenzellen beeinflusst wird (Prinzip der Konvergenz).
Die Kontaktaufnahme
zwischen den Nervenzellen kann erregend (Prinzip der Exitation) oder hemmend
(Prinzip der Inhibition) sein. Für die Erregung und Hemmung sind jeweils
unterschiedliche chemische Botenstoffe (sogenannte Transmitter) verantwortlich.
Für jede
einzelne Nervenzelle berechnen sich daher 2 hoch 1000 (weit nach unten
abgeschätzt 10 hoch 250) mögliche Funktionszustände. Diese Zahl
ist unvorstellbar groß, bei der jede Veranschaulichung scheitert. 10 hoch
250 ist eine Zehnerpotenz mit mit 250 Nullen!
Jedem einzelnen
Sinnesorgan sind eigene Hirn-Bereiche zugeordnet: einerseits für Aufmerksamkeit
andererseits ein Arbeitsgedächtnis.
|
| |
|
|
|
Atemporale
Systemzustände und Zeitfenster im Gehirn
|
|
Für
individuelle Wissens-Konstruktionen sind im Gehirn noch weitere Funktionen
notwendig: einmal bedarf es einer Aktivation (Energie) und zum anderen einer
zeitlichen Koordination der räumlich verteilten Aktivitäten. Im Gehirn gibt
es ein Programm, dass einen Takt vorgibt: Neuronenpopulationen schwingen
oszillatorisch mit der Periode von 3/100 Sekunden. Innerhalb dieser Schwingung
kann im Gehirn eine Information von irgendeinem Punkt zu irgendeinem anderen
gelangen, ohne dass irgendeine "Veränderung" an ihr auftritt. Das Gehirn
schafft sich auf diese Weise atemporale Systemzustände.
Neben diesem Programm gibt es ein weiteres, durch das isolierte neuronale
Ereignisse bis zu 3 Sekunden Dauer automatisch und unverhinderbar zu einem
Kontinuum aneinandergekettet werden. Kontinuität kommt durch inhaltliche
(semantische) Verknüpfung aller derjenigen diskreten mentalen Zustände zustande,
die jeweils in einem etwa 3 Sekunden dauernden Zeitfenster repräsentiert
werden (Roth, 1998, S 182 - 185). |
| |
|
|
| ..... |
.... |
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|