|
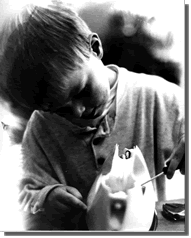
Die
Montessori-Pädagogik
Lernen
in einer
Montessori-Gruppe
Grundbegriffe
zur
Jenaplan-Pädagogik
|
 |
Die
Polarisation der Aufmerksamkeit
Im Mittelpunkt der
Pädagogik Maria Montessoris steht jedoch das Phänomen der Polarisation
der Aufmerksamkeit. (Montessori, Maria, Schule des Kindes, Freiburg 1976;
früher Montessori-Erziehung für Schulkinder, Stuttgart 1926), S. 69 f.)
Damit dieses Phänomen
der Focusierung auf die "innere" Arbeit und Entwicklung des Kindes
eintreten kann, bedarf es bestimmter pädagogischer Bedingungen. Maria
Montessori nennt hier vor allem
- eine vorbereitete
und entspannte Umgebung,
- die Freiheit des
Kindes sich selbst entwickeln zu dürfen,
- die Beachtung der
sensiblen Entwicklungsphasen des Kindes und
- den achtungs- und
liebevollen Umgang des Erzieher mit dem Kind.
Der
Absorbierende Geist
"Das
Kind verfügt über andere Kräfte, und die Schöpfung, die es vollbringt,
ist keine Kleinigkeit: die Schöpfung des Ganzen. Es schafft nicht
nur Sprache sondern formt auch die Organe, die es ihm ermöglichen
zu sprechen. Jede körperliche Bewegung, jedes Element unserer Intelligenz,
alles, womit das menschliche Individuum ausgestattet ist, wird vom
Kind geschaffen."
(Maria Montessori; Das kreative Kind, S.21.) |
Deutlich veranschaulicht
Maria Montessori mit dem Begriff des absorbierenden Geistes das
schöpferische Kräftepotential des Kindes.
|
|
| |
Kinder sind anders,
und Kinder lernen auch anders als Erwachsene. Maria Montessori wie Jean
Piaget verweisen hier deutlich auf die Eigenbedeutung der Kindheit,
womit sie betonen, daß Kindheit nicht nur als Vorbereitung auf das Erwachsensein
gesehen werden kann:
Beide schreiben übereinstimmend,
dass die intellektuellen und moralischen Strukturen des Kindes von denen
der Erwachsenen grundsätzlich verschieden sind, dass aber das Kind dem
Erwachsenen in seinen wichtigsten Funktionen sehr ähnlich ist. Wie er
ist es ein aktives Wesen, und seine Aktivität unterliegt den Gesetzen
des Interesses und innerer und äußerer Bedürfnisse.
Jean Piaget veranschaulicht
diesen Sachverhalt mit dem bekannten Beispiel von der Kaulquappe und
dem
Frosch. Beide brauchen Sauerstoff, doch um ihn aufzunehmen, atmet die
Kaulquappe mit einem anderen Organ als der Frosch. In dieser Weise
handelt das Kind weitgehend wie der Erwachsene, doch mit einer Mentalität,
deren Strukturen je nach seinem Alter verschieden sind. (Maria
Montessori, Grundlagen meiner Pädagogik, München 1934.)
|
|

