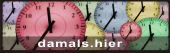Im 19. Jahrhundert fand man in einem Buch im Kloster St. Gallen in der Schweiz den Idealplan eines mittelalterlichen Klosters, der als „St. Gallener Klosterplan“ bezeichnet wird und auf die Zeit um 820 zurückgeht. Nach diesem Plan sind alle mittelalterlichen Klöster erbaut, erst in der Renaissance und im Barock ging man stark davon ab.

Benediktinerstift Marienberg (Foto A. Prock)
Hauptgebäude war die Kirche, an die im Norden oder Süden in Form eines Vierecks der Kreuzgang anschloss.
Von ihm aus konnten alle anderen wichtigen Räume betreten werden:
Kapitelsaal (dort trafen sich täglich die Mönche zum Vorlesen eines Kapitels aus der Ordensregel), Refektorium (Speisesaal),
Sakristei,
Aufgang zum Dormitorium (der Schlafsaal der Mönche lag im Obergeschoß),
Küche, Vorratsräume,
Parlatorium (Sprechzimmer),
Calefaktorium (beheizter Raum) etc.
Bei größeren Klöstern bestanden zusätzliche Gebäude: Ställe, Werkstätten, Bäckerei, Schmiede etc. Grundsätzlich ging es um die Eigenversorgung der Mönche. Klöster lagen ja oft auch in abgelegenen Gegenden. |