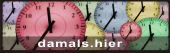|
Gründe für die Ungleichheit |
|
 |
|
index |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Gründe für die Ungleichheit
In mehreren Studien, die die politische Position der Frauen in Südtirol untersuchen, wird als ein Grund für die Ungleichheit der Geschlechterchancen – nicht nur in der Politik - die Mehrfachbelastung der Frauen angeführt, die als Mütter sowohl für Haushaltsführung und Kindererziehung verantwortlich als auch erwerbstätig sind. Im Frauenbericht 2000, der vom Landesbeirat für Chancengleichheit in Auftrag gegeben wurde, wird bestätigt, dass Frauen mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer: im privaten Bereich oft zusätzlich zum Haushalt als Betreuerin von pflegebedürftigen Familienmitgliedern und im öffentlichen Bereich in Form von ehrenamtlicher Betätigung. Sehr oft nehmen Frauen eine Arbeit an, die mit den Zeitvorgaben ihrer häuslichen Verpflichtungen vereinbar sind, nicht weil die Arbeit ihren Interessen und Neigungen entspricht.
In Südtirol gibt es wenige Kinderbetreuungseinrichtungen, wodurch Frauen, die einer Arbeit außer Haus nachgehen und keine familiäre Unterstützung haben, keine Arbeit ausführen können, die flexible zeitliche Verfügbarkeit erfordert. Es sind also zum einen die Alltagsbedingungen, die Frauen von politischer Betätigung, welche unregelmäßig und zeitintensiv ist, abhalten. Zum anderen verhindern die gefestigten männlichen Seilschaften die Integration der Frauen in die Politik. Es wird eine „gläserne“, eine unsichtbare, aber spürbar undurchlässige Decke in die Gefilde der Arbeitswelt und Politik eingezogen, durch die Frauen nur schwer „nach oben“ gelangen können.
Zwar verfügen Frauen ihrerseits inzwischen über funktionierende soziale und politische Organisationen, diese haben im öffentlichen Leben erst mit der Frauenbewegung ab 1968 ihren politisch „organisierten“ Anfang genommen, konnten sich aber bis heute nicht zu einem gefestigten und tragenden Netzwerk mit politischer Unterstützung entwickeln.
Steiner / Flöss
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderung: 04.02.2012
© Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe - Bozen. 2000 -
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Frauen und Politik in Südtirol
- Gründe für die Ungleichheit
|
|
|
|
|
|
|
|