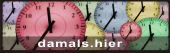Anna Knittel
Was Andreas Hofer unter den Männern für die TirolerInnen ist, ist ihnen die Geierwally unter den Frauen – eine Identifikationsfigur, ein Weibsbild mit Eigenschaften, wie sie nur die besten Mannsbilder des Alpenvolkes vorweisen, eine Unbeugsame, die selbst den Berggeistern trotzt, dem Murzoll und seinen Töchtern, den saligen Fräuleins. Und – weil sie eben eine Frau ist und kein Mann – respektheischend, ja gefährlich.
Zur Schaffung des Heldinnenbildes gingen bei ihr – wie so oft – Wirklichkeit und Fiktion eine Verbindung ein, die nachträglich schwer zu lösen ist. Dabei war die „wahre“ Geierwally, Anna Stainer-Knittel aus dem Lechtal, eine Frau, die der Mythologisierung nicht bedurft hätte: Vielleicht ist sie zum Mythos geworden, weil sie ihr Leben bewusst gelebt hat, selbstbestimmt und eigenwillig. Die Natur, vor der BergbewohnerInnen ansonsten oft bangen, machte ihr keine Angst.
Anna Knittel wurde am 28. Juli 1841 in Elbigenalp im Lechtal geboren, sie war die Tochter eines Büchsenmachers, eine Großnichte des damals bekannten Malers Joseph Anton Koch. Ihre oft boshaften, aber treffenden Karikaturen ihrer MitschülerInnen zeigten schon früh, dass auch sie zeichnerisches Talent hatte. Berühmt wurde sie zunächst aber durch eine „Mutprobe“, die so gut gelang, dass sie sie wiederholte:
In einer Zeit, da man den Adlern – Geier nannte man sie damals abschätzig – nachstellte, weil sie junge Lämmer rissen, schlüpfte sie kurzerhand in die Lederhosen des Bruders und seilte sich an steiler Wand in die Tiefe, um einen Adlerhorst auszunehmen. Kein Mann des Dorfes hatte sich zu diesem Wagnis bereit erklärt, ihr Bruder war bereits vor ihr schon einmal sieben Stunden im Seil gehangen und hatte wenig Lust, dies ein zweites Mal zu tun. So übernahm sie es, die jungen Adler zu holen, sie großzuziehen und später auf einem Jahrmarkt zu verkaufen: Im Jahre 1863 ein Unternehmen, das man einer Frau nicht bzw. nur sehr ungern zutraute.
Schon kurz darauf verpackte der bayrische Reiseschriftsteller Ludwig von Steub die Heldentat in eine literarische Erzählung, und der Lyriker Anton Renk nannte Anna Knittel „Brunhilde vom Lechtal“.
Als schließlich – 12 Jahre nach dem Ereignis – der Roman „Die Geierwally“ erschien, konnte kein Theaterstück, kein Film mehr korrigieren, was die Bestsellerautorin Wilhelmine von Hillern für ihre Geschichte zurechtgebogen hatte: Aus der Anna ist eine Walburga geworden, aus der Tochter eines Büchsenmachers die Tochter eines Bauern, aus dem Lechtal das sagenumwobene Ötztal.
Zugegeben, Anna Knittel hatte selbst ein wenig für Werbung gesorgt, als sie ein Selbstbildnis ins Schaufenster ihres Souvenirladens stellte, das sie beim Ausnehmen des Adlerhorstes zeigt. Die Schriftstellerin Wilhelmine von Hillern hatte dieses Bild im Vorbeigehen gesehen und war gleich Feuer und Flamme: War ihr die Geierwally doch auch so etwas wie ein ganz persönliches Emanzipationsstück: Sie konnte sich freischwimmen von ihrer Mutter, der Bestseller-Autorin Charlotte Birch-Pfeiffer und von einer Gesellschaft, die sie gezwungen hatte, ein uneheliches Kind zu verheimlichen.
„’s is das schönste und stärkste Madel in Tirol“, erzählte der Gemsjäger, “aber spröd wie a wilde Katz – die Buab’n lassen sich von ihr heimjagen, daß es a wahre Schand is. Freili kann sie nix dafür: der Vater hat das Madel lasterhaft viel geschlagen und aufzog‘n wie’n Buab’n.“ (aus: Wilhelmine von Hillern, Die Geierwally)
Als Anna Knittel 1863 den Adlerhorst ausnahm, war sie bereits Studentin in München und hatte sich den für eine Frau vorgesehenen Aufgaben entzogen. Nachdem sie schon als Kind ihr zeichnerisches Talent bewiesen hatte, ihr dies von dem einen und anderen Experten auch bestätigt worden war, hatte sie sich durchgesetzt und war „in die weite Welt“ nach München gezogen.
Wohl besuchte Anna Knittel nicht die staatliche Kunstakademie, da diese bis 1920 allen weiblichen Studierenden verschlossen war, ging aber als „allererstes Frauenzimmer unter lauter Männern“, wie sie stolz in ihrem Tagebuch vermerkt, auf eine private akademische Vorschule.
Als es ihr – nach der Rückkehr – im Lechtal zu eng wurde und das Landesmuseum Ferdinandeum ihr ein Selbstbildnis in Tiroler Tracht abkaufte, zog sie kurzerhand nach Innsbruck, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Das würde sie zeitlebens tun, auch als Mutter von vier Kindern: Den Gatten, den Gipsformator Engelbert Stainer, hatte sie gegen den Willen des Vaters geheiratet, er hatte ein uneheliches Kind mit zu versorgen.
Berühmt wurde sie vor allem für ihre Öl-Landschaften und Blumenbilder; von den Touristen wurden sie ihr fast aus der Hand gerissen. Nach eigenen Angaben malte sie aber auch an die 130 Porträts: darunter die von Erzherzog Karl Ludwig, Feldmarschall Radetzky und Kaiser Franz Joseph I. – signiert hat sie sie immer mit ihrem Mädchennamen. Als die Fotografie die Porträts verdrängte, spezialisierte sie sich auf Blumenbilder, die sie bis zu ihrem Tode malte, und konzentrierte sich im Übrigen auf ihre Zeichenschule für Mädchen. Aufsehen erregte sie, als sie sich die Haare kurz schneiden ließ.
1873 war Anna Stainer Knittel mit dem Ölbild Alpenblumenkranz auf der Wiener Weltausstellung vertreten, für 40 Pfund Sterling wurde es nach England verkauft. Am 28. Februar 1915 starb sie im Hause ihres Sohnes Dr. Karl Stainer in Wattens nach einer nicht ganz ausgeheilten Lungenentzündung.
„Und weiter erzählte der Tiroler dem Fremden: die Mädchengestalt, die sich dort oben gegen den Himmel abzeichne, heiße Walburga Strommingerin, aber man nenne sie auch die Geierwally. Und wahrhaftig, sie verdiente diesen Namen: Denn schrankenlos war ihr Mut und ihre Kraft – als hätte sie Adlersfittiche. Schroff und unzugänglich ihr Sinn, wie die scharfkantigen Felsspitzen, an denen die Geier nisten und die Wolken des Himmels zerreißen.“ (aus: Wilhelmine von Hillern, Die Geierwally)
Als Geierwally wurde Anna Stainer Knittel unsterblich: Unzählige Male wurde der Romanstoff für das Theater adaptiert, der Roman selbst wurde in elf Sprachen übersetzt und dreimal verfilmt – unter anderem als naturalistische Blut- und Boden-Geschichte, als Propagandafilm mit allen Bewohnern des Dorfes Längenfeld und der Luis-Trenker-Entdeckung Heidemarie Hatheyer.
Als Opernheldin La Wally verhalf die Wilde aus Tirol dem Komponisten Alfredo Catalani – einem Zeitgenossen Puccinis – zu seinem einzigen wirklichen Triumph: Entsprechend dem Genre ist Wally am Ende nicht glücklich vereint mit ihrem Geliebten, sondern springt ihm – der von einer Lawine in die Tiefe gerissen wird – in den Tod nach.
Die berühmteste Arie aus der Catalani-Oper diente in nahezu 20 Filmen als Filmmusik, eine zentrale Rolle fällt ihr in dem französischen Kultfilm Diva von Beinix (1981) zu. Lange bedient sich auch schon die Tirolwerbung der wilden Geierwally: Sie steht über der Angst, die die Menschen in diesen Gegenden seit jeher zwingt, mit allerlei Mythen das Überleben zu beschwören. Auch wenn Mythos und Fiktion bald schon die Realität überwucherten, haben sie doch immerhin die Erinnerung an Anna Knittel, die wahre Geierwally, erhalten.
|