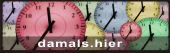Eine "Sage" ist also ein merkwürdiges Zwischending zwischen einer mündlich erzählten Geschichte, die vom jeweiligen Erzähler ja auch immer wieder anders erzählt werden kann, und einer schriftlich niedergelegten Fassung, die dann eine einzige, nun nicht mehr veränderbare Fassung der Geschichte wiedergibt.
Wer ist nun aber der eigentlich "Autor" der Sage? Der meist namenlose Erzähler aus dem einfachen Volk oder der gelehrte Sammler, der die Sage druckreif gemacht hat?
Die "Sagen" sehen so aus, als seien es Berichte von wahrhaftig vorgefallenen Geschichten (s. Beispiele): Der Bursche ist dem Geisterrössl wirklich begegnet: jedenfalls muss er sich ganz ordentlich davor gefürchtet haben. Und der Mesner muss offenkundig beteuert haben, dass er die Hexen leibhaftig gesehen habe. Damals, um das Ende des 19. Jahrhunderts, war ein Mesner ein sehr vertrauenswürdiger Mann, der keine erlogenen Geschichten erzählte. Natürlich gibt es keine Hexen, das wissen wir heute. Was kann denn der Mesner (und nicht nur er!) also gesehen haben?
Diese Fragen haben nichts mehr mit den Sagen selbst zu tun, sondern mit der Erforschung dieser eigenartigen Gattung, die wir heute halb zur Literatur zählen und halb zu einem Wissenszweig, den man früher mit "Volkskunde" bezeichnete. Heute sagt man dazu "Ethnologie" (Völkerkunde) oder genauer gesagt "Kultur- Anthrologie"(Wissenschaft zur Erforschung von kulturellen Referenzsystemen des Menschen).
Und erst heute ist man sich darüber im Klaren, dass die "Sagen" wertvolle Zeugnisse aus einer Zeit sind, die anders funktioniert hat. So wie wir heute denken, haben unsere Vorfahren eben nicht gedacht: auch Weltbilder ändern sich. Das kann man an den überlieferten Erzählungen genau nachprüfen. Die Sagen, oder "Memorate" wie die heutige Erzählforschung sie genauer bezeichnet, enthalten keine erfundene Geschichten, sondern wahre Erlebnisberichte. Es sind also keine literarischen Erzeugnisse der dichterischen Phantasie, sondern so etwas wie "Nachrichten" aus einer Welt, die ein vorwissenschaftliches Referenzsystem hat.
Unser heutiges Weltbild beruht auf der sogenannten "Lesbarkeit der Welt", d.h. wir sind davon überzeugt, dass der gesamte Kosmos, auch sehr schwer erklärbare Phänomene, nach naturwissenschaftlich untersuchten, objektiv nachgewiesenen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Dementsprechend wissen wir, dass der ganze Geisterspuk der Sagen kompletter Unsinn ist; aber das wissen wir erst heute.
Das vorwissenschaftliche Weltbild sieht hingegen hinter und jenseits der sichtbaren Welt eine geistige Dimension am Werk: das Mittelalter war fest in der christlichen Glaubenslehre verankert und hielt den biblischen Schöpfungsbericht für "wahr". Da glaubte man zwar an Geister und Hexen, aber das Vertrauen in die allumfassende Güte und die unvorstellbare Kraft Gottes war so groß, dass man sich im Schutz christlicher Symbole (z.B. dem Läuten der Kirchenglocken) sicher fühlte.
Große Probleme traten erst auf, als das Weltbild der unbedingten Gottesnähe ins Wanken geriet (Ende des 13. Jahrhunderts), die Einsicht in das moderne, naturwissenschaftliche Weltbild (ab dem späten 17. Jahrhundert) aber noch nicht durchgesetzt war. Aus dieser Krisenzeit (Renaissance, Barock) stammen vermutlich die meisten der heute bekannten Sagen. |