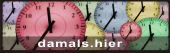Das trockene Reisig knistert und knackt, als es von den Flammen verschlungen wird. „Früher haben wir Autoreifen verbrannt“, sagt Vater, „aber das hat man dann verboten. Wegen der Umwelt“. Wir starren stumm in das Feuer. Rings um uns glühen an den Berghängen und auf den Gipfeln weitere Feuerpünktchen auf. „Woher kommt eigentlich der Brauch vom Herz-Jesu-Feuer?“ frage ich. „Hat irgendwas mit Andreas Hofer zu tun“, sagt mein Vater, aber mehr weiß er auch nicht.

Barock – Dom in Innsbruck ©Foto A. Prock
Die katholische Kirche musste etwas unternehmen, um die Missstände in ihren Reihen auszuräumen und die Lehre Luthers zurückzudrängen. Sie berief ein Treffen der hohen Kirchenfürsten unter Führung des Papstes ein, das Konzil von Trient (1545-1563), in dem es um eine Erneuerung der katholischen Kirche ging.
In drei Perioden konnten Maßnahmen erzielt werden, die zur Festigung der katholischen Kirche dienten. So wurden etwa die Gleichwertigkeit von Heiliger Schrift und Überlieferung, eine straffere kirchliche Verwaltung und eine stärkere Kontrolle der Geistlichkeit beschlossen. Mit diesem Konzil begann die Gegenreformation, das ist die Zurückdrängung des Protestantismus und die Erneuerung der katholischen Kirche. Eine wichtige Rolle spielten dabei religiöse Orden, vor allem die Jesuiten.
Ein wichtiger Aspekt im Zuge der Erneuerung der katholischen Kirche war das Überzeugen der Bevölkerung, dass der katholische Glaube der einzig richtige sei. Dazu trugen in der Zeit des Barock die neuen prächtig ausgestatteten Kirchen, Kapellen, Wallfahrsorte und Stifte bei. Schaulust, Staunen und Überwältigen sind Schlagworte des Barock.
Das Ende des Barock brachte Kaiser Joseph II., ein Anhänger der Aufklärung, welche die Vernunft und die Freiheit des Menschen an oberste Stelle rückt. Zahlreiche religiöse Traditionen kamen zu Fall. Joseph II. griff entscheidend in das religiöse Leben ein; er verfügte die Auflösung zahlreicher Klöster, die Schließung von Kirchen, die Abschaffung vieler Andachtsübungen, eine genaue Regelung des Gottesdienstes, die Einsparung von Kerzen etc.

Stift Marienberg ©Foto A. Prock

Barock – Pfarrkirche Toblach ©Foto A. Prock
Als die Truppen Napoleons Tirol bedrohten, wurde 1796 in der Bozner Pfarrkirche Tirol unter den Schutz des Herzens Jesu gestellt. Die Herz-Jesu-Verehrung ist in Tirol weit verbreitet.
Schon im Jahre 1803 wurden die Fürstbistümer Brixen und Trient aufgelöst; die Bischöfe hatten keine weltliche Macht mehr, sondern standen ihren Diözesen nur noch im religiösen Sinne vor (Säkularisation).

Bild Herz-Jesu-Verehrung – Dom von Bozen
©Foto A. Prock
Tirol war von 1805 bis 1814 unter bayerischer Herrschaft. Der bayerische König schuf einen modernen Einheitsstaat im Sinne der Aufklärung und griff stark in das religiöse Leben der Bevölkerung ein. So wurden Klöster und Stifte aufgehoben, das Rosenkranzgebet, die Weihnachtsmette, das Wetterläuten, das Läuten von Glocken zu bestimmten Anlässen, das Herz-Jesu-Fest und anderes verboten. Gerade diese Verbote waren unter anderem ein Grund für den Aufstand der Tiroler unter der Führung von Andreas Hofer im Jahre 1809.
Eine einschneidende Änderung in der kirchlichen Verwaltung bedeutete die Grenzziehung durch die Friedensverträge von 1919 nach dem Ersten Weltkrieg. Die Diözese Brixen wurde nun auf Italien und Österreich aufgeteilt.
Eine endgültige Regelung der Diözesen erfolgte erst im Jahre 1964. Damals entstanden die Diözese Bozen-Brixen mit Sitz in Bozen und die Diözese Innsbruck.
Heute deckt sich die Diözese Bozen-Brixen mit Südtirol. Die Diözese Innsbruck umfasst das gesamte Osttirol sowie Nordtirol bis zum Ziller, östlich des Flusses gehört Nordtirol zur Erzdiözese Salzburg.
Literatur:
Gelmi Josef: Geschichte der Kirche in Tirol, Innsbruck 2001.
Gelmi Josef: Die Heiligen und Seligen Tirols, Kehl am Rhein 2004.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Von den Anfängen bis zum Jahre 1000, Kehl am Rhein 1994.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Das Mittelalter von 1000 bis 1500, Kehl am Rhein 1995.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Die Neuzeit von 1500 bis 1873, Kehl am Rhein 1996.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Die Neueste Zeit von 1803 bis 1919, Kehl am Rhein 1997.
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Zeitgeschichte von 1919 bis heute, Kehl am Rhein, 1998.
Von Schlachta, Astrid u. a. (Hg.): Verbrannte Erde – Erinnerungsorte der Täufer in Tirol, Innsbruck 2007.
Weger Siegfried und Hölzl Reinhard: Geheimnisvolles Tirol, Innsbruck 2007. |