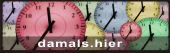|
Das Konzil von Trient (1545-1563) |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Der Wunsch nach Reformen in der Kirche war durch Martin Luther ausgelöst worden, wurde aber auch von Kaiser Karl V. unterstützt. Nur die Kirche selbst war an Reformen wenig interessiert. Nach langjährigem Zögern von Seiten der Päpste konnte endlich Trient als Ort des Konzils festgelegt werden.
Der Papst wollte nämlich einen Ort in Italien, der Kaiser einen Ort in seinem Reich. Die geografische Lage der Stadt Trient – dem Kaiserreich zugehörig, jedoch mit italienischem Charakter – wurde schließlich von Papst und Kaiser als Kompromiss angesehen. Hier fanden nun im Zeitraum von 18 Jahren, mehrmals unterbrochen, die Sitzungen von Kardinälen, Patriarchen und Erzbischöfen statt. Plötzlich stand die kleine unbekannte Stadt im Mittelpunkt des Interesses. Delegationen aus allen europäischen Ländern kamen hierher. Neue Häuser wurden gebaut, breite Straßen angelegt. Heute noch sind viele Bauwerke aus dieser Blütezeit erhalten.
Ergebnisse des Konzils waren eine genaue Festlegung der katholischen Lehre und eine klare Abgrenzung zum Protestantismus. Zu den wenigen, jedoch wichtigen innerkirchlichen Reformen gehörten unter anderem die Abschaffung der Missbräuche im Ablasswesen und die Gründung von Priesterseminaren zur besseren Ausbildung der Priester.
Auch die Einrichtung der Kirchen wurde geändert: das Allerheiligste wurde in den Mittelpunkt des liturgischen Geschehens gerückt und fand im Tabernakel am Hochaltar einen neuen Platz. Für das Volk, das bisher stehend den Gottesdienst mitgefeiert hatte, kamen Kniebänke und geschlossene Beichtstühle in den Kirchenraum. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Änderung: 03.03.2012
© Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe - Bozen. 2000 -
|
|
|
|
 |
|
|
|
|