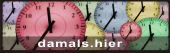Maria Trens – Gnadenmadonna ©Foto A. Prock
Für den mittelalterlichen Menschen war der Glaube etwas Alltägliches. Die Religion beherrschte das Leben. Vieles konnte sich der Mensch nicht auf natürliche Weise erklären, so etwa Naturphänomene wie Gewitter, Überschwemmungen, Sonnenfinsternisse, Erdbeben u. a. In vielem sah er eine Strafe Gottes für Sünden. Das Leben war bestimmt von Gedanken der Versöhnung mit Gott, der Sündenvergabe und Buße sowie die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die zentrale Frage zu allem war: „Was sagt Gott dazu?“

Reliquie ©Foto A. Prock
Wer es sich leisten konnte, wollte sich den Weg in den Himmel durch Stiftungen erkaufen. Darunter versteht man die Widmung eines Vermögens für bestimmte Zwecke: z. B. den Bau von Kapellen, Kirchen, Klöstern, Hospitälern oder deren Ausstattung bzw. für Seelenmessen.
Eine zentrale Rolle spielte die Heiligenverehrung. Die Heiligen waren großteils Märtyrer, also für ihren Glauben gestorben, und wurden von den Menschen als Fürsprecher und Vermittler bei Gott angerufen. Überreste von Heiligen (Reliquien) wurden hoch verehrt und an Wallfahrtsorten ausgestellt.
An Stellen wundertätiger Ereignisse entstanden Wallfahrtsorte. Dazu gehören etwa Maria Trens im Eisacktal, Maria Weißenstein nahe Bozen, St. Georgenberg bei Schwaz, Kaltenbrunn im Kaunertal und viele andere. Wallfahrtsorte sind auch heute noch von großer Bedeutung.
Religiöse Bruderschaften kümmerten sich um das Seelenheil ihrer Mitglieder, stellten aber auch wichtige soziale Institutionen dar, die sich um Arme, Kranke und Alleingelassene annahmen.
|