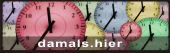Tirol als Durchgangsland zwischen Mittel- bzw. Nord- und Südeuropa war schon immer verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, die in zahlreichen Kunstwerken ihren Niederschlag fanden. Vor allem entlang der wichtigen Verkehrswege in den Haupttälern (Inntal, Silltal, Eisacktal, Etschtal, Pustertal) entstanden bedeutende religiöse Kunstwerke, von denen viele noch erhalten sind.

St. Prokulus in Naturns - außen
©Foto A. Prock
Die ältesten Spuren christlicher Kunst gehen auf die Römer zurück. Reste von altchristlichen Kirchen finden sich in Säben südlich von Brixen, in Aguntum, Imst und auf dem Martinsbühel bei Zirl.
Einige Kunstwerke aus karolingischer Zeit (8./.9. Jahrhundert) haben sich im Vinschgau erhalten, so die Wandmalereien in St. Prokulus in Naturns, in St. Benedikt in Mals und im schweizerischen St. Johann in Müstair.
Die Zeit der Romanik (ca. 1000 - ca. 1250) brachte eine Blüte der Wand- und Deckenmalerei. Von den vielen Beispielen im Süden des Landes sind die Burgkapelle von Hocheppan, die St. Jakobskirche in Tramin, die Krypta der Klosterkirche von Marienberg und in Osttirol die Nikolauskirche bei Matrei zu nennen. Künstlernamen sind keine bekannt. Der bedeutendste romanische Kirchenbau ist die Stiftskirche von Innichen im Pustertal.
Hauptkennzeichen der gotischen Architektur (ca. 1250 - ca. 1520) ist der Spitzbogen. Ihr Höhepunkt in Tirol ist von ca. 1450 bis 1520 zu sehen und fällt mit dem Reichtum durch den Bergbau, vor allem Silber- und Kupferabbau, zusammen. In den Städten und auf dem Land entstanden damals zahlreiche neue Kirchen, ausgestattet mit Flügelaltären und Wandmalereien. Dazu gehören die Pfarrkirchen von Meran, Sterzing, Bozen, Hall, Landeck, Rattenberg, Kufstein, Lienz. Eine Sonderstellung nehmen die gotischen Schnitz- und Flügelaltäre ein. Namen von Künstlern sind schon bekannt, denkt man etwa an Michael Pacher, Hans Multscher und Jörg Lederer. An weltlichen Bauwerken entstanden Stadthäuser und zahlreiche Burgen.

Pfarrkirche Schwaz – außen ©Foto A. Prock
Aus dem Süden kommend, löst die Renaissance (ca. 1520 - ca. 1620) die Gotik ab. Nun wird neben der religiösen Kunst auch die weltliche wichtig, z. B. die Porträtmalerei. Die Renaissance-Architektur hielt vor allem bei Schlossbauten (Tratzberg, Ambras, Feldthurns, Brixner Hofburg) und bei Privatkapellen (Silberne Kapelle in Innsbruck) Einzug. Auch das Maximiliansgrabmal in der Innsbrucker Hofkirche zählt zu den Renaissancekunstwerken. Ein schönes Beispiel dieses Stils ist weiters die Rupertkapelle in der Pfarrkirche von Villa Lagarina in Welschtirol. In der Malerei und bei den Reliefs tritt die Zentralperspektive auf.
Eng mit der religiösen Volkskunst sind Barock und Rokoko (ca. 1620-ca. 1760) verbunden. Die Türken-gefahr war mit der erfolglosen zweiten Belagerung Wiens beseitigt, die Habsburger standen auf dem Höhe-punkt ihrer Macht. Bis in die kleinsten Täler wurden Kirchen umgebaut oder neu errichtet. Dazu gehören die Stadtpfarrkirche (der heutige Dom) St. Jakob in Innsbruck, der Dom in Brixen, die großen Stifte (Neustift bei Brixen, Marienberg, Gries bei Bozen, Stams, Fiecht, Wilten), die Basilika Wilten, die Liebfrauenkirche auf Säben und viele mehr. Eigenartigerweise hat sich im Etschtal der neue Stil nicht stark verbreitet, umso mehr im nördlichen Tirol.
Während der Süden des Landes vor allem von Italien beeinflusst ist, zeigt der Norden die Orientierung nach Süddeutschland. Bedeutende Baumeisterfamilien waren im Süden die Delai, im Norden die Gumpp und die Singer. Als Tafel- und Freskomaler sind vor allem Mitglieder der Familien Waldmann und Kessler, Paul Troger, der Augsburger Matthäus Günther, der Wiener Hofmaler Josef Adam Mölk, Martin Knoller, Michelangelo Unterberger sowie Mitglieder der Künstlerfamilien Zoller und Zeiller zu erwähnen. In der Plastik und im Altarbau nahmen Andreas Thamasch, Cristoforo und Teodoro Benedetti sowie Dominikus Molling eine herausragende Stellung ein.

Pfarrkirche Sterzing – außen ©Foto A. Prock
Dem Barock folgt der Klassizismus (ca. 1770-ca. 1820), in der Malerei etwa vertreten durch Josef Schöpf.
Das 19. Jahrhundert wird von der Romantik und dem Historismus beherrscht. Im Historismus wurden vergangene Stile aufgegriffen und neu interpretiert, man spricht von Neuromanik, Neugotik, Neurenaissance, Neubarock etc. Neben Kirchen im neuromanischen Stil (Pfarrkirchen von Bruneck und Telfs, Herz-Jesu-Kirchen in Bozen und Innsbruck) sowie im neugotischen Stil (St. Nikolauskirche in Innsbruck, Grabstätte Erzherzog Johanns in Schenna nahe Meran) entstanden im Zuge der Stadterweiterung ganze Stadtviertel im Stil des Historismus (z.B. Villenviertel im Innsbrucker Saggen und in Meran). Die Malerei dieser Zeit wird von der Gruppe der Nazarener bestimmt, die ihre Ursprünge in der gotischen Kunst sehen. Zu ihnen gehören Franz Hellweger aus St. Lorenzen im Pustertal, Franz Stecher aus Nauders und Caspar Jehle sowie Franz Plattner und Albert Steiner von Felsburg. Als wohl bedeutendster Historienmaler ist Franz von Deferegger anzusehen.
Der Jugendstil steht an der Wende zum 20. Jahrhundert. Im folgenden Expressionismus tritt Albin Egger-Lienz besonders hervor.

Silberne Kapelle in Innsbruck – innen ©Foto A. Prock

St. Prokulus in Naturns – Malerei innen ©Foto A. Prock
Literatur:
Gelmi Josef: Geschichte der Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, 5 Hefte (von den Anfängen bis zur Gegenwart), Kehl am Rhein, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Gelmi Josef: Geschichte der Kirche in Tirol, Innsbruck 2001.
Naredi-Rainer Paul, Madersbacher Lukas (Hg.): Kunst in Tirol – Von den Anfängen bis zur Renaissance, Innsbruck-Wien-Bozen 2007.
Naredi-Rainer Paul, Madersbacher Lukas (Hg.): Kunst in Tirol – Vom Barock bis in die Gegenwart, Innsbruck-Wien-Bozen 2007.
Die Gotik – Tiroler Ausstellungsstraßen, Mailand 1994.
Barock und Rokoko – Tiroler Ausstellungsstraßen, Mailand 1995.
Andergassen Leo: Kunstraum Südtirol, Bozen 2007. Andergassen Leo: Südtirol – Kunst vor Ort, Kunstführer Südtirol, Bozen 2002. |