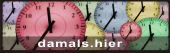In den Adelshäusern wurden Ehen meist schon im frühen Kindesalter geschlossen.
Gründe dafür waren die frühe Ausschaltung der Konkurrenz bei politisch vorteilhaften Verbindungen und die bestmögliche Ausnutzung der weiblichen Fruchtbarkeit durch eine große Kinderanzahl, da viele Kinder das Erwachsenenalter nicht erreichten. Liebe spielte grundsätzlich keine Rolle. Eheabsprachen der Eltern erfolgten oft mit der Geburt der Kinder, aber auch manchmal schon vorher. Die jungen Eheleute sahen sich meist erst kurz vor der Hochzeit. Heiratsverträge mussten geschlossen sowie rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden. Bei zu naher Verwandtschaft der Brautleute war päpstliche Dispens einzuholen.
Zur Hochzeit mussten Braut und Bräutigam zusammenkommen, wobei meist die Braut zum Bräutigam reiste. Bei Staatsheiraten konnte ein Stellvertreter des Bräutigams zur Braut reisen und die Trauung „per procurationem“ vor Zeugen durchführen. Dazu stieg der Vertreter des Bräutigams mit der Braut in ein Bett und entblößte sein rechtes Bein oder er streckte sein schon entblößtes rechtes Bein zu ihr ins Bett.
Die eigentliche Hochzeitsfeier mit dem Bräutigam fand etwas später statt. Erst mit dem Vollzug war die Ehe voll gültig und nach kirchlicher Auffassung unauflöslich. Eine gültig geschlossene und vollzogene Ehe konnte nur durch den Tod aufgelöst werden, eine Ehescheidung bestand grundsätzlich nicht. Nur bei erwiesener Unfähigkeit des Mannes, den ehelichen Akt zu vollziehen, war eine Scheidung möglich, jedoch nicht bei Unfruchtbarkeit der Frau.
Das Ehealter wurde meist mit dem Eintritt der Geschlechtsreife definiert - bei Knaben das 14. Lebensjahr, bei Mädchen das 12. In Fürstenhäusern konnten gültige Eheversprechen schon ab dem 7. Lebensjahr der Brautleute erfolgen. Die Hauptaufgabe fürstlicher Ehefrauen war die Geburt von Kindern, vor allem von Knaben, zur Sicherung der Nachfolge. Fehl-, Früh- oder Totgeburten und das frühe Sterben von Kindern gehörten zum Leben der Frauen. |