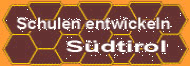|
Wir
sehen: Lernen ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die sich der direkten
Beeinflussung weitgehend entzieht. Die Prozesse sind so vielfältig, individuell
unterschiedlich, unkontrollierbar, dass wir unser Augenmerk mehr auf
- die
Beobachtung der Lernenden
-
das Umfeld, in dem dies geschieht,
-
die Qualität der "Lernanstöße"
und weniger auf das Belehren richten müssen.

Das
Ressourcenspiel: Konzentration, Teamfähigkeit
und soziales Engagement
sind gleichermaßen gefordert
|
|
Besonders wichtig
erscheinen:
- Schule braucht
die Zuwendung zu einer Sache in aller Ruhe: Stoffdruck, Stress, Hektik,
angespannte Atmosphäre sind hinderlich.
- Strukturelles
Lernen, vernetztes Denken müssen gefördert werden, auch scheinbar nicht
zur Sache gehörende Assoziationen sind zu würdigen, als Ergebnis eines
Denkprozesses vorerst zu akzeptieren und darauf einzugehen.
- Eintönigkeit muss
vermieden werden, was aber nicht mit blinder Betriebsamkeit verwechselt
werden darf.
- Wir müssen vorsichtig
sein mit Regeln und zu frühen Automatismen: verstehen kommt vor üben,
Regeln sollten selbst gefunden werden.
Es lassen sich zusammenfassend
einige provokante Aussagen zum Thema "Lernen in der Schule" formulieren:
- Jeder ist für
seine Lernprozesse selbst verantwortlich. Es kann niemand zum Lernen
gezwungen werden, auch Kinder nicht. Wer also nicht lernen will, wird
am besten aus der Schulpflicht entlassen. Die Schule wird sonst zu einem
Hüterdienst degradiert.
- Wir können so
lernen, dass wir unser Gehirn und seine Funktionsweise optimal nutzen.
Die Strukturen unserer Schulen erlauben das nicht. Jahrgangsklassen,
vorgegebene Zeitgefäße, Auffächerung, zu große Lerngruppen, unzweckmäßige
Lernräume, fehlende Methodenvielfalt und anderes mehr verhindern ein
"gehirngerechtes" Lernen.
- Soll das Lernen
in der Schule erfolgreich verlaufen, muss es konsequent individualisiert
und differenziert werden.
- Wenn wir Lehrkräfte
verhindern wollen, dass zunehmend mehr Eltern mit Psychopharmaka die
Lernprozesse ihrer Kinder positiv zu beeinflussen versuchen, müssen
wir ein Gegengewicht schaffen. Das können wir tun, indem wir uns an
den Forschungsergebnissen der Neurobiologie orientieren.
|