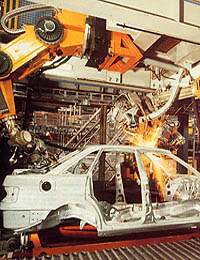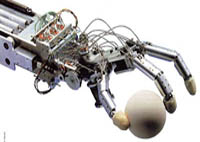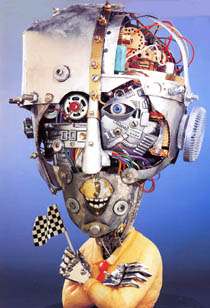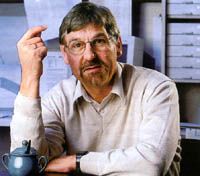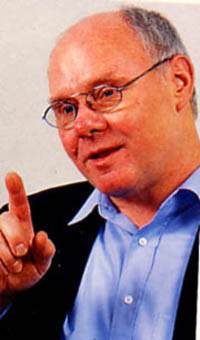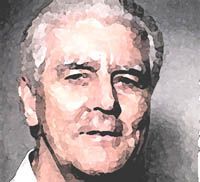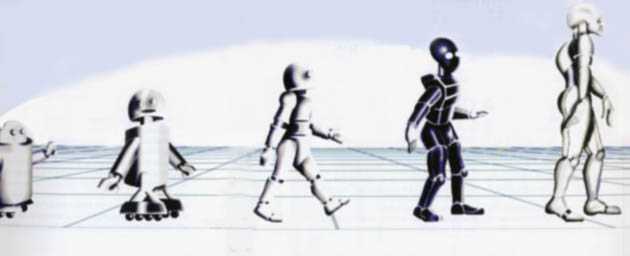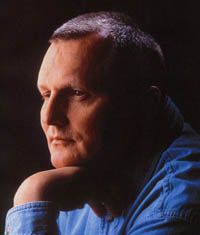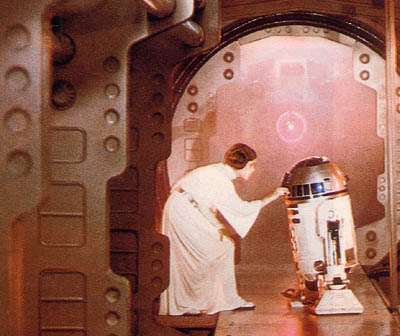|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Stand der Technik: Handhabungsautomaten
und
Roboter mit Gefühl für Balance und Zupacken
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| Stand
der Wissenschaft: Der "Implantationsmensch"
|
|
| |
|

|
|
Herzen,
Lungen, Nieren und Gelenke - ein ganzes Ersatzteillager biologischer,
gentechnischer und künstlicher Organe - liegen heute zum "Einbau"
bereit. Transplantationen gehören zum Alltag der High-Tech-Medizin.
Die grundsätzliche Frage nach der Identität des Menschen, der
mit einer ganzen Palette fremder Organe lebt, spielt aber noch keine Rolle.
Schlagartig wird sich dies ändern, wenn technische Prothesen in das
Gehirn implantiert werden. Denn schließlich gilt dieses Organ als
der Ort menschlichen Bewusstseins und der Gefühle.
Gehirnprothesen würden auch das gängige Todeskonzept durchkreuzen.
Denn, wenn es mit ihnen möglich würde, alle ausgefallenen Hirnregionen
durch Neuro-Implantate zu ersetzen, dann könnte der Mensch letztlich
sogar unsterblich werden.
So wird die Neuro-Technik unser Weltbild und unser religiöses Verständnis
fundamentaler verändern, als alle bisherigen wissenschaftlichen Errungenschaften.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Stand der Wissenschaft:
eine Delphi-Prognose |
|
|
|
|
|
|
| |
|
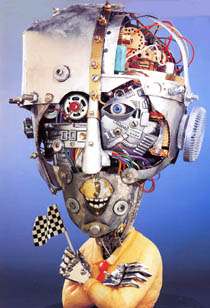
|
|
Wie in
nebenstehender Plastik stellen sich Künstler einen mit technischen
Artefakten bestückten Kopf vor. Sie konstruieren damit ihre subjektive
Aussage von der Wirklichkeit: Abschreckend soll sie sein, Ängste
soll sie wecken, damit sie erst gar nicht wird!
Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der Neurobiologie und der künstlichen Intelligenz-Forschung
machen sich zur Zeit noch kein Bild vom äußerlichen Aussehen
eines nachbiologischen Lebewesens, aber sie entwerfen ihre Prognosen darüber
auf der Basis der Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten.
In so genannten
Delphi Studien werden Expertinnen und Experten über zukünftige
Entwicklungen ihrers Arbeitsbereiches befragt.
Delphi-Prognosen sind also keine künstlerischen oder literarischen
Entwürfe von der Zukunft, sondern wissenschaftliche Erwartungen unter
Einschätzung auch von gesellschaftlichen und ethisch-moralischen
Einstellungsänderungen.
Eine Delphi-Prognose lautet:
Experten halten bis zum Jahre 2008 solche Neuro-Computer
für realisierbar, die wie das menschliche Gehirn Daten verteilt speichern
können, wenn für deren Evolution genügend Geld verfügbar
ist.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Stand
der Wissenschaft:
Ideen für zukünftige Entwicklungen |
|
|
|
|
|
|
| |
| Ideen
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für zukünftige Entwicklungen
gehen über Delphi-Prognosen hinaus. Sie enthalten immer auch persönliche
Interessen, die sie "verkaufen" müssen, da für ihre
Entwicklung und Verwirklichung häufig viel Geld notwendig ist. |
| |
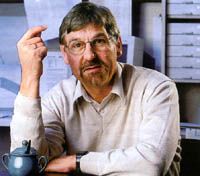 |
|
z.B.:
Gerhard Roth, Professor für Hirnforschung:
"Auf der einen Seite fühlt man sich als Hirnforscher geschmeichelt,
wenn viele Leute zu den eigenen Vorträgen kommen. Wenn man aber darlegt,
dass Geist und Bewusstsein mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht
werden können, dass man vielleicht Geist und Bewusstsein wird nachbauen
können, dann kommt oft große Angst auf."
Wenn Gerhard Roth sich nach einem Vortrag so äußert, dann steckt
in dieser Aussage auch ein Idee davon, welche Ziele er in zukünftigen
Entwicklungen anstrebt.
|
|
|
.... |
|

Verbindung von Nervenzellen
mit technisch neuronalen Systemen
|
|
z.B.:
Hans-Werner Bothe, Professor für Neurochirurgie in Münster
und z.B.: Michael Engel, Wissenschaftsjournalist für Neurobionik:
"Seit Hunderten von Jahren versuchen Menschen die besonderen Leistungen
ihres Denkapparates zu erklären, doch erst seit kurzer Zeit ist es
möglich, die spezifischen Fähigkeiten des Gehirns wie Lernen
und Gedächtnis auf neuartigen Computerprogrammen - den neuronalen
Netzen - zu installiern. In dieser "technischen Verfügbarkeit"
des Gehirns - wenn auch derzeit noch in sehr rudimentärer Form -
liegt der eigentliche Reiz der Neuroforschung."
Wenn sich Hans-Werner
Bothe und Michael Engel in der Einleitung ihres Buches "Neurobionik"
(Umschau Verlag Frankfurt 1998) so äußern, dann erwarten sie
eine Fülle von Neuroprothesen für das menschliche Gehirn, die
mit dem menschlichen Nervensystem kommunizieren, sich also verständigen
können.
|
|
|
.... |
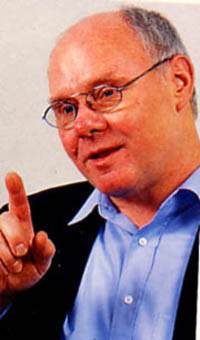 |
|
z.B.:
Werner Dörner, Professor für Psychologie:
"Der Mensch kann nicht vernetzt denken und er denkt viel zu langsam."...
"Wir
erleben heute z.B. immer wieder, dass wenn mehr als 3 Parameter miteinander
wechselwirken, wir ohne mediale Hilfen kaum noch in der Lage sind, die
Wechselwirkungen zu verstehen."
Die Abhängigkeiten zwischen Preis und Nachfrage zu erkennen, das geht
noch. Aber wenn Werbung, Nachfrage, Preis, Gewinn, Geldstabilität, Steuern,
Renten, Bevölkerungswachstum, Informationskosten, Sozialkosten, Umweltkosten
und Arbeitsplätze - um nur einige wechselwirkende Parameter zu nennen
- miteinander vernetzt auf die Zielgrößen eines humanverträglichen,
ökologieverträglichen und generationenverträglichen Lebens erkannt werden
sollen, dann streikt unser Gehirn.
Neuronale
Systeme, implantiert in unser Gehirn, wären ein Lösungsweg.
Denn die Komplexitäten müssen verstanden werden und in unserer
Gesellschaft von ganz vielen Menschen gesehen werden, damit Umwertungen
in unserem Handeln überhaupt stattfinden können.
|
|
|
... |
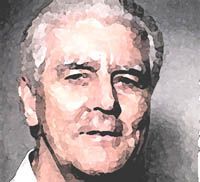 |
|
z.B.: Willi van
Lück, Bildungsplaner:
Ein humanerer Weg (nicht humanistischer
Weg), als implantierte Neuronen, ist ein Neuverständnis
von Lernen und darauf beruhend eine Qualitätsverbesserung
des Lernens in Schule und Weiterbildung auch mittels Neuer Medien.
Hypermediale Lernsysteme - wie z.B. diese Lern- und Arbeitsumgebung -
die auf der Grundlage einer konstruktivistischen Lerntheorie gestaltet
sind, können die Lernenden zu eigenen Fragen anregen, können subjektive
Interessen und Gefühle aufgreifen, können hohe Komplexitäten modellieren
und simulieren, können assoziativ an persönliche Erfahrungen und Wissenskonstruktionen
anknüpfen, können für sinnliche Wahrnehmungen und authentische Begegnungen
aufschließen.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Visionen über nachbiologische
"Lebens"formen
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Visionen
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über zukünftige
Entwicklungen etwa über nachbiologischen "Lebens"formen gehen
weit über Delphi-Prognosen und interessengeleitete Ideen hinaus. Sie
enthalten immer auch persönliche Phantasien von der Zukunft. Aber an
der Realisierung dieser Visionen zur Evolution nachbiologischer Lebewesen
wird in KI-Team in allen Industrieländern gearbeitet, gebastelt und
geforscht. |
| |
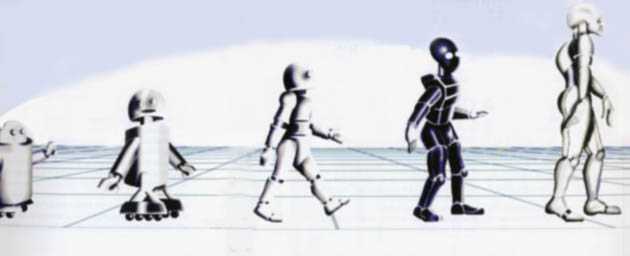 |
| |
 |
|
Christof
von Malsberg, Bochumer Professor für Neuroinformatik, gehört
zu den Weltbesten, die sich um eine automatisierte Gesichtserkennung durch
Parallelrechner (siehe: Neuronale Netze) verdient gemacht haben. Er gewann
gegen eine starke US-Konkurrenz in einem Wettbewerb, den das Militär
ausgeschrieben hatte, den ersten Platz. Er sagt:"Es ist sicher, dass
es bereits in wenigen Jahren denkende Maschinen geben wird, die den Menschen
ganz fürchterlich vom Thron stoßen werden." |
| |
|
|
 |
|
Jon
McCaskill und Uwe Tangen vom IBM in Jena mit dem Rechner "Polyp".
Der Bildschirm zeigt, wie sich ein Schaltkreis selbständig weiterentwickelt.
Sie formulieren:
"Wir befinden uns an der Schwelle zum Zeitalter des evolutiven Maschinen-Designs." |
| |
|
|
 |
|
Hugo
de Garis bezeichnet sich als "Brain Builder". Seine Maschinen-Katze
soll nächstes Jahr durch die Flure des ATR-Laboratoriums in Kyoto,
Japan, laufen. De Garis ist sicher: In Zukunft werden künstliche Gehirne,
wie er sie baut, die Herrschaft auf der Erde übernehmen. Er sagt:
"Die künstlichen Gehirne könnten uns bald töten wie
Insekten." |
| |
|
|
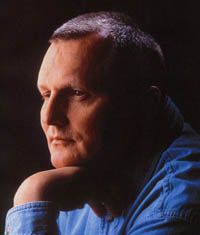 |
|
Hans Moravec, Professor
für Robotertechnik am MIT formuliert:
"Was vor uns liegt, kann als Entwicklung neuer Lebensformen bezeichnet
werden. ... Die jetzige Computergeneration wurde bereits mit Hilfe der
vorangegangenen Generation konstruiert und hätte auch nicht anders konstruiert
werden können - sie ist zu komplex. ... Und wegen der Beschleunigung der
Entwicklungen lässt sich voraussagen, dass irgendwann Informationen in
der Lage sein werden, unabhängig von uns zu leben. Vermutlich in der Form
von Maschinen die sich selbst produzieren und ihre eigenen Nachfolger
konstruieren. ..."
siehe
auch: Literaturhinweise
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Science fiction in
"Buch" und "Film" |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nebenan ein Ausschnitt aus einem fast schon antiken Film, in dem Roboter
auftraten, die die Herzen der Zuschauer gewannen. Es waren "liebevolle"
Maschinen, die die Gesetze der Roboter von Assimov voll erfüllten:
Ein
Roboter darf keinen Menschen verletzen.
Er
muss den Anweisungen des Menschen gehorchen, wenn sie nicht im Widerspruch
zum ersten Gesetz stehen.
Er
soll seine Existenz sichern, solange dies nicht gegen das erste und zweite
Gesetz verstößt.
|
|
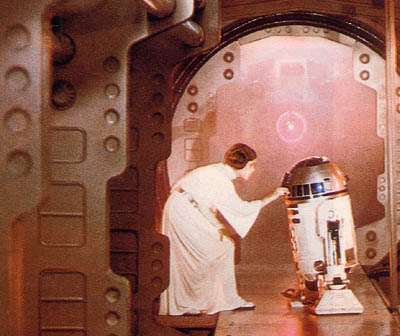
|
|
|
|