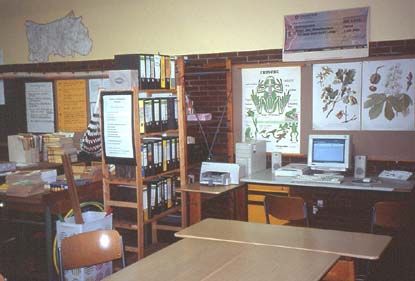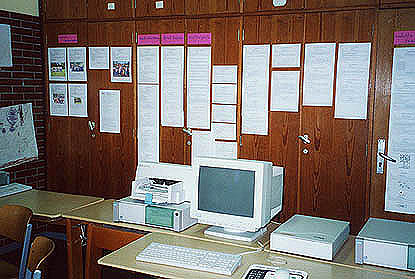|
Inszenierung
und Vorbereitung des Projektes
|
|
Als "amtierender"
Pate der medialen Arbeitsumgebung kündigte ich das Projekt bereits im
Juli 1999 an. In dieser Ankündigung wurde von mir zunächst das Thema und
der zeitliche Rahmen festgesetzt. Darüber hinaus wurde derselbe Text per
E-Mail an bekannte, vermutlich interessierte Schulen abgeschickt. Diese
mehr persönliche Ansprache hat eine größere Wirkung auf die Bereitschaft,
sich am Projekt zu beteiligen. Es ist daher für zukünftige Projekte sicher
nützlich, möglichst viele interessierte Schulen zu kennen. Eine Unterrichtskizze
zum Projekt "Du hast angefangen!" - "Nein, du!" wurde dann etwas später
veröffentlicht. Sie enthielt hauptsächlich überfachliche, soziale Lernziele,
methodische Überlegungen zu deren Realisierung, geschätzte Lernzeiten
sowie mögliche inhaltliche Anknüpfungspunkte für eine überregionale Kommunikation
und Kooperation. Im Zeitraum zwischen Ankündigung und Beginn des Projektes
wurden dann Absprachen organisatorischer, technischer und inhaltlicher
Art unter den teilnehmenden Lehrpersonen getroffen. Solche Absprachen
haben sich bei allen bisher durchgeführten Projekten als notwendig und
hilfreich für die Durchführung erwiesen. Der Austausch zwischen den Lehrpersonen
erfolgte in der Regel über E-Mail.
|
|
Ein
Blick in die Lernarbeit einer Klasse
|
|
In einer vierten Klasse
der Grundschule Pantrings Hof in Herne hatten sich zum Projektthema unter
Moderation des Lehrers vier Kleingruppen (noch vor Projektbeginn) gebildet.
Die Kinder wollten arbeitsteilig an den folgenden Unterthemen lernen und
arbeiten:
- Streitbeispiele
mit Lösungen
- Ich möchte nicht
mehr streiten!
- Was kann man tun,
um Streit zu beenden?
- Streitschlichtung
an unserer Schule
Bei der Themenarbeit
wurde die Mediothek des Lern- und Arbeitsbereiches "Friedensfähigkeit"
von den Kindern als zusätzliches Medium, neben den anderen vom Lehrer
bereitgestellten Medien, genutzt.
|
|
|
|
In allen Kleingruppen
wurden passend zu ihren Unterthemen auch Beiträge für das Schwarze Brett
zunächst auf Papier und sodann mit einer Textverarbeitung geschrieben.
Letzteres war und ist für Grundschulkinder zeitaufwendig. Sie müssen die
einzelnen Buchstaben auf der Tastatur erst suchen. Die erstellten Kommunikationsbeiträge
wurden sodann abgeschickt.
Am
nächsen Morgen erwarteten die Kinder Antworten von den anderen beteiligten
Lerngruppen. Alle waren gespannt, ob die anderen Schülerinnen und Schüler
aus NRW oder Südtirol geschrieben hatten und was sie zu den eigenen Beiträgen
meinten oder zu fragen hatten. So setzten sich zunächst die Kinder der
Kleingruppe "Streitbeispiele mit Lösungen" in die Medienecke und riefen
das Schwarze Brett und dort zuerst den Kommunikationsbereich "Vorstellung
der beteiligten Lerngruppen" auf, weil sie wissen wollten, ob wohl noch
weitere Gruppen bei dem Projekt mitmachen wollten. Sie
wurden nicht enttäuscht!
|
|
|
|
Die Kinder lasen die
Beiträge und diskutierten sie in ihrer Gruppe. Sie kopierten die Beiträge
für die Kommunikationswand im Klassenraum, planten weitere Aktionen und
besprachen Organisatorisches. Ein Ergebnis ihrer Tätigkeiten war der Beschluss,
auf der Grundlage der stattgefundenen Gespräche am Schwarzen Brett ein
Fallbeispiel - ähnlich wie es in der Mediothek vorgemacht worden war -
einmal selbst darzustellen. Nun wurden Ideen gesammelt und der Lehrer
half beim Entwickeln der Struktur des zu erstellenden Drehbuches.
Ähnlich lebhaft ging
es auch in den anderen drei Gruppen zu. Die Kleingruppe "Ich möchte nicht
mehr streiten!" hatte zum Beispiel nach Anregungen aus der Mediothek acht
Gefühle beschrieben, sie durch Kinder dargestellt und davon Fotos gemacht.
Diese Texte und Bilder sollten dann am Schwarzen Brett präsentiert werden.
Dazu scannten die Kinder die Fotos ein und schrieben die Texte mit einer
Textverarbeitung. Überarbeitet und auf die richtige Rechtschreibung hin
überprüft wurden sodann die Texte und Bilder in die Eingabemaske des Schwarzen
Brettes kopiert. Doch zuvor gab es ein Problem. Es wurde diskutiert, welcher
der folgenden Kommunikationsbereiche des Schwarzen Brettes dabei gewählt
werden sollte.
- Vorstellung der
beteiligten Klassen oder
- Fallbeispiele von
Gewalt / Konfliktsituationen oder
- Wege zur Lösung
von Gewalt / Ideen zur Konfliktbewältigung oder
- Ideen zur Steigerung
der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit oder
- Ideen zur Einrichtung
einer Streit-Schlichtung in der Schule oder
- Selbst verfasste
Geschichten und Gedichte oder
- Ideenbörse für
soziales Lernen
Hierbei war die Hilfe
des Lehrers gefragt! Er schlug vor, für die Darstellung von Gefühlen den
Bereich "Ideen zur Steigerung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit"
zu wählen. Das Abschicken der Bilder und Texte gelang dann noch am selben
Tag. Und wieder waren die Kinder gespannt, ob es Reaktionen darauf geben
würde: "Einige der Worte in der Beschreibung der Gefühle sind vielleicht
bei den Kindern in Südtirol nicht bekannt. Dann kann es Fragen geben!"
|
|
Erfolgreiche
Projekt in der Grundschule - Warum?
|
|
Diese geschilderten
Einblicke in die Lernarbeit der Grundschulklasse zeigen eine typische
arbeitsteilige Kleingruppenarbeit im Sachunterricht während des Projektes.
Die Kinder arbeiten in diesem Projekt zum wiederholten Mal arbeitsteilig
in Kleingruppen. Sie haben schon öfters und in vielen anderen Sachzusammenhängen
Projekte durchgeführt. Und dabei haben sie immer wieder auch ihre Kommunikations-
und Kooperationsfähigkeit geschult.
Die Lehrperson ist
ständig im Einsatz, denn die Tätigkeiten der Kinder in den Kleingruppen
sind vielschichtig und die Kinder haben viele zielgerichtete fachliche
Fragen. Sie moderiert die Lernarbeit der Kinder, indem sie Anregungen
gibt, organisatorische Voraussetzungen schafft, Hilfen bei technischen
Problemen gibt und dabei mit den Schülerinnen und Schülern lernt. Zu Beginn
und am Ende einer Unterrichtseinheit organisiert und leitet sie gemeinsame
Klassengespräche, die dem Informationsaustausch, der Darstellung von Planungen
und dem Vorstellen von Ergebnissen (auch Teilergebnissen) sowie der Klärung
organisatorischer Fragen dienen. Bisher "getrenntes" Wissen wird in diesen
Phasen zu einem allgemeinen und orientierenden Wissen für alle.
Die Kommunikation
und Kooperation in der Klasse und überregional muss übersichtlich strukturiert
sein. Beobachtungen während durchgeführter Projekte zeigen u.a., dass
die Übersichtlichkeit der Kommunikationsplattform im Bildungsserver um
so größer ist, je differenzierter sie gestaltet ist. Eine zuerst lebhafte
Kommunikation "erstickt", wenn die Kinder ihre eigenen Beiträge und die
der anderen nicht mehr finden können. Eine Aufteilung in mehrere Kommunikationsbereiche
erleichtert somit das Auffinden von Texten. Als weiterhin hilfreich und
sinnvoll für das Lernen hat sich erwiesen, dass die Kommunikationsbeiträge
geordnet an Stellwänden in der Schule veröffentlicht werden. In der Grundschule
ist dies möglich, denn die Gesamtzahl der Beiträge (etwa 60 bis 80) bleibt
überschaubar.
Zusätzlich werden
die ausgedruckten Kommunikationsbeiträge auch in den Arbeitsordnern der
Kleingruppen abgeheftet. Diese Sammlungen in den Ordnern erleichtern der
Kleingruppe das Erstellen von Folge-Beiträgen für die Kommunikation am
Schwarzen Brett. Ebenso werden in diesen Ordnern alle weiteren Textbeiträge,
von den Ideensammlungen bis hin zu den fertigen Arbeiten, übersichtlich
abgelegt. Mit Hilfe dieser Dokumentation können die Arbeitsergebnisse
der Kleingruppe festgehalten und die Präsentationen vor der Klasse besser
vorbereitet werden. Die Ordner stellen für die Lehrperson eine zusätzliche
Grundlage dar, die Kommunikation und Kooperation zu würdigen und in die
Leistungsbewertung mit einzubeziehen.
Multimediale Dokumente
der Kinder und Erfahrungsberichte der Lehrpersonen werden nach dem Projekt
(etwa im Foyer des Arbeitsbereiches) veröffentlicht. Immer wieder sind
einige Arbeiten der Kinder so gut gelungen, dass sie von den Paten in
die Mediothek eingestellt werden. Aber aus Zeitgründen können diese Arbeiten
- in der Regel - nicht zeitgleich mit dem Projektablauf von den Paten
geleistet werden. Daher werden viele aufwendige Produkte, sowie eine Dokumentation
der abgelaufenen Kommunikation im Projekt nachträglich im Foyer veröffentlicht.
Ebenso werden dann auch die Erfahrungsberichte der Lehrpersonen öffentlich
gemacht. Insgesamt gesehen lassen sich aber in Grundschulen überregionale
Kommunikations- und Kooperationsprojekte einfacher planen und durchführen
als in Sekundarschulen. Das Prinzip, in Grundschulklassen viele Fächer
in eine Hand zu legen, macht dies möglich. So kann der Unterricht fachübergreifend
und organisatorisch sehr flexibel an die momentanen Lernbedürfnisse angepasst
werden. Es ist in der Regel gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt Mathe,
Sache oder Sprache unterrichtet wird.
|