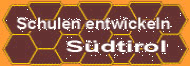|
|
|
|
|
|
|

|
|
Diese
"Gedankensplitter zur Situation"
sind entnommen den Ausführungen
"Die Autonomie der Schulen"
(Veröffentlichung Nr. 9 des PI, 1998, Seite 165ff.)
(Alfred Niederhofer)
Siehe
dazu auch: SCHILF: Aufbruch von Innen
|
| |
|
|
|
|
|
Die Schulen sind heute
einem gesellschaftlichen Druck wie nie zuvor ausgesetzt. Allein schon
durch die Fülle von Bildungs- und Erziehungszielen, die, kunstvoll und
künstlich in den Inhalten der einzelnen Fächer verpackt, den Jugendlichen
eingeträufelt werden sollen, wird ein Lehrer schier erdrückt. Zusätzlich
zu diesen offiziell verordneten Aufgaben wird die Schule mit unzähligen
Angeboten von öf-fentlichen und privaten Institutionen beglückt.
|
| |
|
|
|
Reform
von unten
|
|
Die Schulen Südtirols
haben sich in den vergangenen 15 Jahren gewaltig verändert. Es gibt keine
Oberschule die in dieser Zeit nicht durch Schulversuchstätigkeiten umstrukturiert
wurde. Viele Schulen nehmen an den verschiedensten EU-Angeboten wie Comenius
und Lingua teil. Wöchentlich berichtet die Lokalpresse von Schulprojekten.
Auf alle Fälle sind in unseren Schulen Dynamik und Engagement vorzu-finden.
Obwohl sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
in den vergangenen Jahren nicht besonders lehrerfreundlich entwickelten,
waren es gerade die einzelnen Lehrerkollegien, die sich der Herausforderung
der Zeit stellten und in Eigenregie wertvolle Reformarbeit leisteten.
|
| |
|
|
|
Wer
rastet, der rostet
|
|
Der Landeskollektivvertrag
und die Anwendung des Bassanini-Gesetzes stellen eine weitere Herausforderung
an und eine große Chance für unsere Schulen dar. Es ist heute klarer denn
je, dass der Entwick-lungsprozess, der nun eingesetzt hat, nicht stehen
bleiben darf - wer rastet, der rostet! Für eine echte schulische Entwicklung
ist die dauernde Weiterbildung aller Akteure unerlässlich. Ein Eckpfeiler
dieser Entwicklung ist die schulinterne Lehrerfortbildung (SCHILF).
|
| |
|
|
|
Im
Mittelpunkt steht der Mensch Schüler
|
|
Angesichts der Gefahr,
sich bei Zielsetzung und Inhaltswahl aufgrund unüberblickbarer Einzelheiten
zu verzetteln, ist immer wieder die Rückbesinnung auf das Wesentliche,
auf den Schüler als Person, anzumahnen. Die Arbeit des Lehrers besteht
in erster Linie im Umgang mit Menschen. Die Entfaltung des Jugendlichen
im umfassendsten Sinn steht im Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
und des Lehrers an erster Stelle. Gerade hier gilt es, die klassische
Forderung "non multa sed multum" ernst zu nehmen. Das einzelne Fach kann
und muss daher viel häufiger Mittel zum Zweck werden und kann und muss
nicht nur um seiner selbst willen unter-richtet werden.
|
| |
|
|
|
Ausbildungsnotstand
|
|
Bisher ist die gesamte
Lehrerausbildung auf den Universitäten in entgegengesetzte Richtung und
sehr singular verlaufen. Fachspezialisten wurden herangezüchtet, und diese
tradierten ihre selbsterlebte Ausbildung generationenlang an die Jugend
weiter. Der so ausgebildete Lehrer kann den im Gesetz und in den Lehrplänen
vorgesehenen Bildungs- und Erziehungsauftrag schwer erfüllen.
|
| |
|
|
|
Der
Paradigmenwechsel
vom Fachlehrer
zum Pädagogen
|
|
Aufgrund der geschilderten
Situation ist es vorrangige Aufgabe des Lehrers, sich neben der fachspezifischen
Qualifikation didaktische und pädagogische Werkzeuge zu erarbeiten und
anzueignen, um die Jugendlichen in ihrer persönlichen Entfaltung verantwortungsvoll
begleiten, betreuen und fördern zu können. Nur durch diesen Paradigmenwechsel
kann eine wirksame und zukunftsträchtige Schulentwicklung in Gang gesetzt
werden, und nur im Dienste dieser Schulentwicklung findet Schulautonomie
ihren Sinn und ihre Rechtfertigung.
|
|
|
|