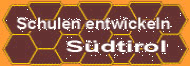|
|
|
|
|
|
|
Landwirtschaftliches Praktikum ist das erste schulspezifische, landwirtschaftliche
Fach, mit dem die Schüler/innen in Kontakt kommen. Es ist ein praktisch
ausgerichtetes Fach, in dem theoretische Erklärungen nur Hilfsfunktion
haben.
Der Unterricht in diesem Fach wird im schuleigenen landwirtschaftlichen
Lehrbetrieb durchgeführt, wobei über die Durchführung der verschiedensten
landwirtschaftlichen Tätigkeiten den Schülern ein erster systematischer
Zugang zur Landwirtschaft geboten wird.
|
|
 |
| |
Der
praktische Unterricht bietet Einsichten in Betriebsabläufe und Anbauzyklen
und eröffnet Einblicke in ökologische und ökonomische Zusammenhänge in der
Landwirtschaft.
Darüber hinaus vermittelt
er ein Verständnis für die bäuerliche Lebens- und Arbeitswelt sowie für
geschichtliche und kulturelle Aspekte der Landwirtschaft.
Durch den landwirtschaftlich-praktischen
Unterricht lernen die Schüler/innen, eigene Fähigkeiten und Eignungen zu
erkennen und weiterzuentwickeln sowie Verantwortung für das eigene Handeln
einzuüben. Die praktischen Erfahrungen im landwirtschaftlichen Betrieb ermöglichen
es den Schüler/innen, Freude am Tätigsein und an erbrachter Leistung zu
erfahren, Verantwortungsbewusstsein gegenüber Lebewesen zu pflegen und auch
das ästhetische Empfinden durch den direkten, mit allen Sinnen erfahrbaren
Umgang mit der Natur zu schulen. Auch fördert das praktische Lernen die
Sozialkompetenz, indem verschiedene Formen der Zusammenarbeit bei der Durchführung
konkreter Tätigkeiten als wichtige Voraussetzung für das Gelingen erfahren
werden. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Bezüge
zu den Schwerpunkten
|
|
Ziele
des Praktikums |
| |
|
|
|
|
- Einschlägige Arbeiten
im landwirtschaftlichen Betrieb zuverlässig und sachlich richtig durchführen
lernen und spezielle Fertigkeiten einüben;
|
|
Landwirtschaft,
Natur und Umwelt in ihrer Vielfalt
|
|
- Landwirtschaftliche
Phänomene genau beobachten lernen, sie untereinander in Beziehung setzen
und die Beobachtungen in Worte fassen können;
|
|
|
|
- Naturwissenschaftliche
und landwirtschaftliche Sachverhalte richtig deuten und Zusammenhänge
herstellen können; Schaffung einer Wissensbasis im Bereich Landwirtschaft
als Grundlage für die landwirtschaftlich-technischen Fächer im Triennium;
|
|
|
|
- Erkennen und Überschauen
verschiedener Betriebsabläufe;
|
|
Sprache
und Kommunikation
|
|
- Entwickeln einer
situationsbezogenen Fachsprache;
|
|
Identität
und Beziehung
|
|
- Die eigenen Fähigkeiten
und Kenntnisse bei der Durchführung der verschiedenen Tätigkeiten einsetzen
lernen;
|
|
|
|
- Freude am eigenen
Tun und Beobachten finden.
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Inhalte
des Praktikums |
| |
|
|
Landwirtschaft, Natur und Umwelt in ihrer Vielfalt

|
|
- Obstbau: Ernte,
Baumschnitt, Vermehrung und Pflanzung, Pflegemaßnahmen; Weinbau und
Kellerwirtschaft: Ernte, Weinbereitung, Rebschnitt, Vermehrung und Pflanzung,
Pflegemaßnahmen;
- Viehwirtschaft:
Nutztierrassen, Haltungs- und Aufstallungsformen, Fütterung und Tierpflege;
- Milchverarbeitung:
Milchgewinnung und Milchverarbeitung;
- Gartenbau: Bodenvorbereitung,
Bepflanzungsplan und Aussaatkalender, Gartenbau im Gewächshaus, Kräuter
und Gewürzpflanzen;
- Forstwirtschaft:
wichtige Baumarten, Waldtypen, Pflegearbeiten, Bestandserhebungen, Altersbestimmung;
- Ackerbau und Grünland:
Heimische Kulturpflanzen, Grünland;
- Boden: Bodenentstehung,
einfache Bodenanalysen, Bodenorganismen, Bodenfruchtbarkeit, Bodenbearbeitung,
Bodengefährdung, Kompostierung;
- Landwirtschaft
in Südtirol: Voraussetzungen landwirtschaftlicher Tätigkeit, verschiedene
landwirtschaftliche Produktionszweige, betriebliche Organisation, verarbeitende
Betriebe.
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Methoden |
| |
|
|
|
Methodenvielfalt

|
|
Bei
der Auswahl der Lerninhalte wird auf die lokalen und jahreszeitlichen Gegebenheiten,
auf die Interessensschwerpunkte der Schüler/innen und die Möglichkeiten
des landwirtschaftlichen Lehrbetriebs Rücksicht genommen. Das praktische
Lernen steht im Vordergrund.
Durch das eigenständige Durchführen der verschiedensten Arbeiten erwerben
die Schüler/innen eine gewisse Handfertigkeit, schärfen ihre Beobachtungsgabe
und erreichen Grundkenntnisse in den verschiedenen landwirtschaftlichen
Bereichen. Einzelne Themenbereiche eignen sich gut für die Erarbeitung in
Projektform, dabei können auch die Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens
besonders zum Tragen kommen. Begleitet werden die praktischen Tätigkeiten
vom Gespräch in der Klasse, in dem für das Verständnis notwendige theoretische
Erklärungen ihren Platz finden. |
| |
|
|
|
Sprache
und Kommunikation
|
|
Dabei
lernen die Schüler/innen schrittweise wichtige Fachbegriffe kennen und lernen
die Sachverhalte und Arbeitsabläufe in Worte fassen. In diesem Zusammenhang
wird auch Wert gelegt auf das bewusste Aufgreifen und Reflektieren von dialektalen
landwirtschaftlichen Begriffen. Fächerübergreifende Zusammenarbeit mit den
Lehrpersonen der Sprachfächer hat hier einen großen Stellenwert. Auch das
Darstellen, Präsentieren und Dokumentieren von Übungsschritten und Arbeitsergebnissen
in Wort und Bild bilden wichtige Lernelemente. |
| |
|
|
|
Öffnung
der Schule
|
|
In
Ergänzung zu den Übungen am landwirtschaftlichen Lehrbetrieb stellen Lehrausgänge
und Betriebsbesichtigungen eine wichtige zusätzliche Möglichkeit der Vermittlung
bestimmter Themenbereiche und des Einblicks in die Vielfältigkeit der lokalen
Landwirtschaft dar. |
|
|
|