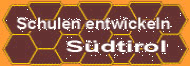|
|
|
|
|
|
 |
|
Offen:
Was tust du, wenn... Welche Möglichkeiten hast du... Womit würdest du beginnen?
Geschlossen:
Hast du...?
Wer? Wo? Wann? Wie? Weshalb?
Hier handelt es sich um Informationsfragen:
Das Fragewort muss an den Anfang.
Zu vermeiden sind:
Vorwürfe: Warum hast du...?
Suggestivfragen: Glaubst du nicht auch,...?
Alternativfragen: X oder Y?
Kettenfragen: Meinst du A, B oder Z?
Inquisitorische Fragen: Jetzt sei aber ehrlich |
| |
|
|
|

Modell
zwei
und Präzissionsfragen sind der Weg zu konstruktiver Kommunikation
|
|
Präzisionsfragen
gehen verdeckten Sachverhalten nach; sie decken auf, was durch Verallgemeinerung,
Tilgung, Verzerrung verschleiert wurde. So entsteht Sprache. Eine Sprache
zu lernen, bedeutet notwendigerweise, dass verallgemeinert wird: Der Stuhl
steht für Sitzgelegenheit, die Einzelstühle verschwinden. Es bedeutet Tilgung:
Bestimmte Bereiche der Wirklichkeit werden ausgeklammert, z.B.: Der Franzi
hat mich verletzt. Die klassische Frage, die diese Tilgung aufdeckt, ist:
Wie hat er dich verletzt? Es bedeutet Verzerrung: Die Wirklichkeit reduziert
sich auf die Farben schwarz und weiß: Du bist schuld, dass es mir schlecht
geht. Zu glauben, der andere sei für die eigenen Gefühle verantwortlich,
ist eine Verzerrung. Dies alles muss aufgelöst werden, um die verlorenen
Informationsteile wieder ins Bewusstsein zu rücken. Es geht um Wahrheitssuche
- um die "Wahrheit der Situation" (nach Schulz von Thun), nicht um die absolute
Wahrheit. Es geht darum, mehr Validität und Sicherheit in unserem Wissen
herzustellen.
Präzisionsfragen bewirken, dass hinter dem Problem neue Probleme auftauchen.
Der Lernprozess ist nicht der, dass Lösungen geliefert werden, sondern der,
dass neue Fragen gestellt werden. Nicht die Antworten machen das Lernen
aus, sondern das Finden neuer Fragen. Der Horizont wird erweitert, der Blickwinkel
verändert. Dadurch entsteht lernen. Freilich muss dabei ein gewisses Risiko
eingegangen werden: " Wenn Sie nicht riskieren, falsche Fragen zu stellen,
werden Sie nicht lernen, gute Fragen zu finden." Ein Hindernis dafür, Präzisionsfragen
zu stellen, ist oft, dass der Berater sich mit dem Problem des Klienten
identifiziert. Der Berater muss lernen, neutral zu bleiben, nicht Partei
zu ergreifen. Aus dieser Gesprächstechnik ergibt sich auch, dass es Unterschiede
gibt und dass dies richtig ist. Die Geschichte vom pädagogischen Eros kann
so nicht stimmen, d.h. dass ein guter Lehrer / Direktor nicht alle gleich
lieben muss. Es darf ruhig Unterschiede geben, sofern der nötige Respekt
gewahrt bleibt. |
| |
|
|
| |
|
Ein
Beratungsgespräch wird simuliert: Eine Person/Gruppe stellt sich als Klient
zur Verfügung, und zwar mit einem realen Problem. Ein Berater übernimmt
es, die "richtigen" Präzisionsfragen zu finden. Dabei hat es sich gezeigt,
dass der Einstieg in das Beratungsgespräch gut überlegt sein sollte. Auch
ist es wichtig, dass der Berater bei sogenannten Signalwörtern wie z.B.
Schwierigkeiten nachhakt, z.B. mit der Frage: Was für Schwierigkeiten sind
das? Wenn der Berater selbst Gefahr läuft, zum Klienten gemacht zu werden,
hilft oft folgende Frage: Ich bitte euch, in der Gruppe abzusprechen, wie
ihr mir in Zukunft helfen könnt, solche Fehler nicht mehr zu machen (das
Problem in den Griff zu bekommen). |
|
|
|