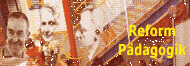|
|
|
|
|
|
|
gesellschaftliches und
schulisches Leistungsprinzip
pädagogischer
und
unpädagogischer Leistungsbegriff
die
Normalverteilung - höchst
problematisch in der Pädagogik
Verbalzeugnisse:
empirische Untersuchungen
pädagogisches
Leistungsverständnis
|
 |
Leistungen sind nicht
an sich schon gut oder schlecht, Leistungsbewertung erfolgt immer auf
dem Hintergrund anderer Leistungen, die als Basis eines Vergleichs dienen.
Anders ausgedrückt: Leistungsbeurteilung setzt eine Bezugsnorm voraus.
Ohne klare Angabe dieser Bezugsnorm sagt die Leistungsbewertung wenig
aus. Je nachdem, welche Bezugsnorm verwendet wird, kann die gleiche Leistung
entweder als relativ gut oder auch als relativ schlecht bewertet werden.
Man unterscheidet
drei Arten von Bezugsnormen:
- Die
individuelle Bezugsnorm:
Dabei wird die aktuelle Leistung eines Schülers mit seinen eigenen früheren
Leistungen verglichen - bewertet wird der Lernfortschritt des Schülers.
Gut ist eine Leistung dann, wenn der Schüler sich gegenüber seinen früheren
Leistungen verbessert oder wenigstens nicht verschlechtert hat.
- Die
sachliche oder kriteriale Bezugsnorm:
Dabei werden die Leistungen an sachlichen Vorgaben wie den Anforderungen
des Lehrplans oder des "Programms" gemessen, die unabhängig von der
Leistung der Klasse festgesetzt werden. Gut ist eine Leistung, die diesen
Anforderungen entspricht.
- Die
soziale Bezugsnorm:
Hier orientiert sich die Bewertung der individuellen Leistung am Durchschnitt
der Klasse, sie wird in Beziehung gesetzt zu den Leistungen der anderen
Schüler in der Klasse. Gut gearbeitet hat ein Schüler dann, wenn seine
Leistung besser ist als der Durchschnitt der Klasse.
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Die Verwendung der
einen oder anderen Bezugsnorm bei der LB ist dabei keine rein technische
Frage, sondern ist "verbunden mit den fundamentalen erzieherischen und
politisch-gesellschaftlichen Zielen, die wir verfolgen" (Sacher, 1996,
S. 47).
Für die Entscheidung,
welche dieser drei Bezugsnormen in der Schule angebracht ist, können die
folgenden drei Bewertungskriterien hilfreich sein:
- Sind
die gesellschaftlichen und schulischen Voraussetzungen für eine Beurteilung
nach der jeweiligen Bezugnorm überhaupt gegeben?
Vergleicht man die drei Bezugsnormen mit den bestehenden
Verhältnissen in Schule und Gesellschaft, so entspricht die soziale
Bezugsnorm ihnen zweifellos am besten. "Die verbreitete Leistungsbeurteilung
nach der sozialen Norm ist vermutlich ein Stück heimlicher Lehrplan
unserer competitiven und leistungsorientierten Gesellschaft" (ibid.,
S. 51).
Die Bewertung nach der sachlichen Bezugsnorm ist ebenfalls gut mit den
gesellschaftlichen Werten vereinbar: "Die Berufung auf Sachansprüche
ermöglicht es, jeden bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit zu
fordern" (id.).
Soziale und sachliche Bezugsnorm passen demnach recht gut in das Konzept
einer leistungsorientierten Gesellschaft, und es ist deshalb nicht verwunderlich,
dass sie von gesellschaftlichen "pressure groups" offensiv vertreten
werden und die Praxis in unseren Schulen weitgehend bestimmen.
Dies gilt nicht für die individuelle Bezugsnorm. Sie ist in der Leistungsgesellschaft
eher verpönt (außer in Randbereichen wie bei der Bewertung der Leistungen
von Behinderten), und dies gilt weitgehend auch für die Schule. Hinzu
kommt, dass eine solche Leistungsbewertung konträr zur schulischen Tradition
steht und nur sinnvoll ist, wenn der Unterricht dieser Bezugsnorm angepasst
ist und den Schülern "differenzierte und flexible Lernangebote gemacht
würden." (ibid., S. 50)
|
|
| |
|
|
|
| |
|
- Inwieweit
ist die jeweilige Bezugsnorm mit den allgemeinen Erziehungszielen der
Schule kompatibel?
Es gibt in unseren Demokratien, wenigstens in der Theorie, einen weitgehenden
Konsens darüber, dass die Heranwachsenden zu "mündigen und verantwortlichen
Mitgliedern unserer Gesellschaft erzogen werden sollen, zu Selbstbestimmungs-
und Solidaritätsfähigkeit" (ibid, S. 48). Und es ist offensichtlich,
dass die drei Bezugsnormen und die ihnen zugrunde liegende Weltanschauung
sehr unterschiedlich mit diesen Erziehungszielen vereinbar sind.
Eine Leistungsbeurteilung nach der sozialen Norm steht zu den erwähnten
Zielvorstellungen in deutlichem Widerspruch.
Bei der kriterialen Bezugsnorm "ist die Außengeleitetheit und -bestimmtheit
nicht so direkt... Aber die vorgebliche Orientierung an sachlichen Erfordernissen
ist oft nur eine geschickte Tarnung sozialer Beeinflussung... Immerhin
aber ermöglicht die kriteriale Norm Schülern Kooperation" (ibid., S.
48-49), jedenfalls bis zu einem bestimmten Grad: spätestens bei Prüfungen
ist Schluss damit.
Es ist relativ eindeutig, dass nur die individuelle Bezugsnorm den gesellschaftlichen
Zielvorstellungen voll entspricht, auch wenn dabei sachliche und soziale
Normen mitberücksichtigt werden müssen. "Aber nur die individuelle Norm
repräsentiert einen Maßstab, der nicht von außen an die Leistung eines
Schülers herangetragen wird. Hier wird jeder an sich selbst und an seinen
eigenen Fähigkeiten gemessen" (ibid., S. 49). Besonders der Förderauftrag
der Schule ist mit der sozialen Bezugsnorm völlig unverträglich, und
harmoniert auch nicht so recht mit der kriterialen Bezugsnorm (für alle
die gleichen Lernziele).
|
|
| |
|
|
|
| |
|
- Welches
sind die nachweisbaren oder vermuteten Auswirkungen einer entsprechenden
Beurteilung?
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen
besonders zu den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der drei Bezugnormen
(s. dazu Sacher, 1996, S.53-55). Bei dem Vergleich zwischen der individuellen
und der sozialen Bezugsnorm sprechen die Resultate ziemlich eindeutig
für die individuelle Norm - die soziale Bezugsnorm erweist sich empirisch
als in vielerlei Hinsicht problematisch.
Über die Auswirkungen der kriterialen Bezugsnorm gibt es nur wenige
Forschungsresultate. Sacher vermutet aber, dass auch hier problematische
Folgen zu befürchten sind, weil "mit Berufung auf die kriteriale Norm
oft glatte Überforderungen legitimiert werden ... und weil die Orientierung
an sachlichen Anforderungen kriterial urteilenden Lehrern reichlich
Motivationsprobleme bei ihren Schülern eintragen dürfte" (S. 55).
Als Fazit aus der
Bewertung der drei Bezugsnormen nach den drei zurückbehaltenen Kriterien
ergibt sich ein sehr widersprüchliches Bild: Während die gesellschaftlichen
und schulischen Voraussetzungen ziemlich eindeutig für die soziale Bezugsnorm
sprechen, lässt sich aus der Perspektive der Erziehungsziele und der Auswirkungen
der verschiedenen Normen die individuelle Bezugsnorm am ehesten vertreten,
während die soziale Bezugsnorm deutlich negativ bewertet werden muss.
|
|
|
|
|