|
Alle
Tageszeitungen, Wochen- und Monats-Zeitschriften sowie Fachzeitschriften
haben Ende 2001 und Anfang 2002 ein Bild vom Unvermögen der deutschen
Kinder und Jugendlichen im "Lesen" und "Rechnen" gezeichnet.
Und in dieser Folge werden ganz schnell Lösungen angeboten. "Wirtschaftsbosse"
in Deutschland attakieren z.B. die sogenannte Soft-Schule und fordern
wieder mehr Leistung. Bildungspolitiker fordern u.a. für Grundschulen
die Ganztagesschule und, und ...
U.a. stellen sich
Fragen, Fragen, ...,
die zum Nach-Denken herausfordern sollen. Anworten sind
erwünscht in der Galerie und auf den Foren
Können
überhaupt schnelle Lösungen erwartet werden, wenn in der Schule
mehrfach überlernte Unterrichtsskripte über
viele Lernjahre auf Schülerinnen und Schüler eingewirkt haben?
Haben
diese eingeübten "strengen" Unterrichtsskripte überhaupt
etwas mit der Soft-Schule zu tun? Oder sind es nicht gerade diese lehrerzentrierten
Unterrichtsmodelle, die die Misere verursacht haben?
|
|
"Der
Studien-Rat" von
Reinhard Kahl, in: DIE ZEIT Nr.49
Pisa fragt nicht den
Stoff von Lehrplänen ab, es prüft erstmals, was Schüler für das Leben
brauchen. ... Es geht weniger ums Buchstabieren von Texten als um die
Lesbarkeit der Welt: um Verständnis, Orientierung, Handelnkönnen. Auch
Mathematik erscheint hierbei als eine Sprache, die Verstehenshorizonte
öffnet. Ihren Code zu beherrschen heißt mehr als nur rechnen können. Mathematik
kann zum Umgang mit Modellen befähigen. ...
Pisa untersucht "die Fähigkeit, sich in Alltagssituationen zurechtzufinden.
Aber der Schlüssel für dies alles ist die Beherrschung der Alltagssprache.
... "Mangelnde Sprachbeherrschung nimmt die Chancen, selbständig zu lernen,
auch mit modernen Medien. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass die modernen
Medien Sprache ersetzen, das Gegenteil ist der Fall", so Baumert ...
Jürgen Baumert fasst ein Ergebnis von Pisa wie folgt zusammen: "Je anspruchsvoller
die Matheaufgaben werden, desto deutlicher treten die Schwächen der deutschen
Schüler hervor."
Baumert fragt: Wie kommt es, dass bei deutschen Schülern das schematische
Denken dominiert? Warum vermeiden so viele von ihnen die lustvolle Anstrengung,
den eigenen Verstand zu gebrauchen? Warum kommt in deutschen Schulen die
Kreativität zu kurz? Und er fragt weiter: Was ist zu tun?
Baumerts erste Antworten lauten: "Bloß mehr Unterricht zu verlangen, wenn
er nicht besser wird, macht alles eher noch schlimmer". Er sagt weiter:
"Misstrauen Sie allen schnellen Lösungen. Die Veränderung deutscher Schulen
braucht eine Generation. Das lange mitgeschleppte und "überlernte" deutsche
Unterrichtsskript, das die Schüler nicht zur Selbständigkeit und Neugier
animiert, ist zu überwinden." ... "Lehrer müssen sich endlich dafür interessieren,
welche Wirkungen sie erzeugen. Sie müssen lernen, sich nicht hinter einer
Klassentür abzuschotten. Sie müssen offen sein, für Kritik und Hilfe.
Das ist für die meisten Berufe heute selbstverständlich, warum nicht auch
für die Lehrer?"
Baumert weist mit der Untersuchung nach, dass der Leistungsstand der Schüler
weder von der Klassengröße noch von der Menge der Unterrichtsstunden abhängt
und schon gar nicht von der Systemfrage: Gesamtschule oder Gymnasium.
Wichtiger sind das Klima, ja der Geist und der Eigensinn der jeweiligen
Schule. Es kommt darauf an, dass der Unterricht "kognitiv anspruchsvoll"
ist, ob Schüler lernen, Probleme schrittweise zu zerlegen und Lösungen
selbständig zu finden. Schüler müssen eigene Wege, auch Umwege, suchen
und lernen diese zu reflektieren. Es hilft nicht, wenn Schüler nur scheinheilig
so tun, als ob sie alles verstanden hätten?
Von sich selbst sagt Baumert: "Ich gehöre zur letzten Generation, in der
man noch Generalist sein konnte." Heute braucht man eine frühe Spezialisierung,
um mitspielen zu können. Aber Spezialisierung ist nur die eine Hälfte
der neuen Konstruktion. Die andere heißt "Anschlussfähigkeit".
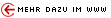 ww.zeit.de/2001/49/pisa
ww.zeit.de/2001/49/pisa
|
|
Lehrpersonen
müssen die verbindlichen Anforderungen der Lehrpläne erfüllen.
Pisa fragt aber - im Gegensatz zu TIMSS - nicht unbedingt nach dem "Stoff"
von Lehrplänen. Wie steht es daher mit der curricularen Validität?
Welche
Folge-Probleme ergeben sich daraus, wenn man den untersuchten Zielen
in PISA recht gibt?
Und
die Diskussion geht weiter.

|
|
ZEITCHANCEN
SPEZIAL: DER SCHULSCHOCK, in
DIE ZEIT Nr. 50 (6.12.01)
Ein lehrreiches
Desaster - Das deutsche Bildungssystem hat versagt:
Es ist ungerecht und produziert Mittelmaß - das zeigt die internationale
Schulstudie Pisa. Aber die Untersuchung liefert auch Anstöße
für einen besseren Unterricht / von Thomas Kerstan
Wieso,
weshalb, warum? - Über die Ursachen der Bildungsmisere
und wie man Schule besser machen kann. Jürgen Baumert und Hermann
Lange im ZEIT-Gespräch
"Die
Bürokratie geschlachtet" -
In Schweden dürfen die Schulen entscheiden, welche Lehrer sie einstellen
und wie sie unterrichten. Im Gegenzug müssen sie sich regelmäßig
testen lassen / von Reinhard Kahl
Die
Musterschüler Finnen sind die Pisa-Sieger - Warum sie
so gut sind / von Reinhard Kahl
Wir
sind schlauer! Freude in Großbritanien, Frust in Luxemburg,
Gelassenheit in Japan - wie die Welt auf den Schultest reagiert / von
Blume, Kleine-Brockhoff, Marusczyk
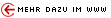 www.zeit.de/2001/50/pisa www.zeit.de/2001/50/pisa
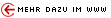 www.zeit.de/2001/50/schweden www.zeit.de/2001/50/schweden
|













